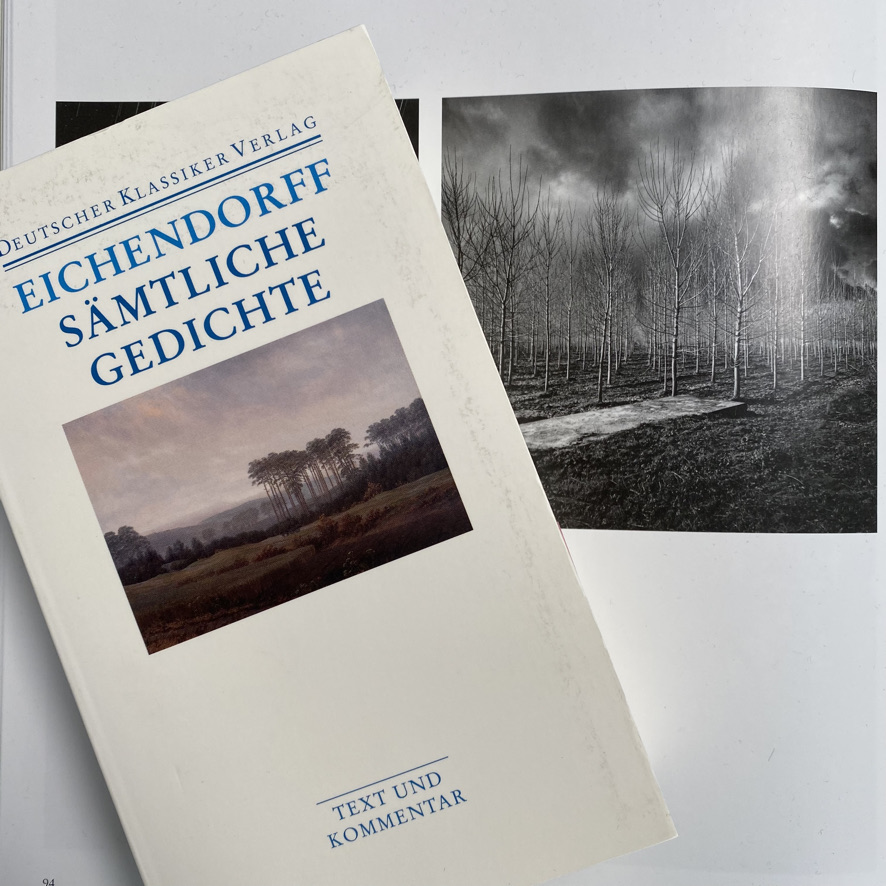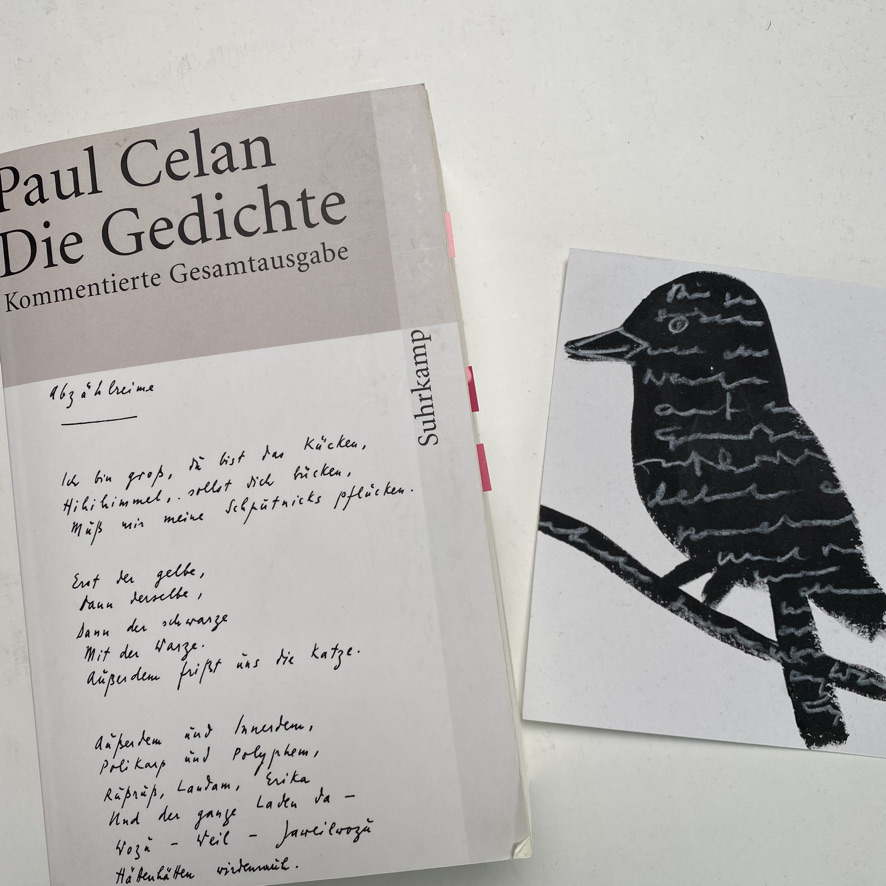Es war eine schöne Woche, eine überraschende Woche, eine lehrreiche Woche, eine arbeitsame Woche. Es war eine Woche, in welcher ich durch viele Erlebnisse und auch durch meine Gedanken dazu Erkenntnisse gewann. Insofern fallen die heutigen Inspirationen vielleicht ein wenig anders aus als sonst.
Was hat mich diese Woche inspiriert, welche Erkenntnisse habe ich gewonnen?
Egal wie andere Menschen Dinge anpacken, ich muss für mich meinen eigenen Weg finden. Diese Erkenntnis klingt ziemlich banal und offensichtlich, und doch kam sie mir diese Woche wieder ganz bewusst in den Sinn. Ich habe seit vielen Jahren eine Schwäche für die Schreibprozesse anderer Autoren. Und immer wieder, wenn mich einer begeistert, denke ich, dass sein Schreibprozess «der Richtige» sei. Und bin dann erst mal blockiert für eine Weile. Bis ich wieder zu meinem eigenen zurück finde.
Es bringt nichts, über ungelegten Eiern zu brüten. Das fiel mir mal wieder auf, als ich etwas frustriert in die Woche startete, welche in der Agenda und in den Wetterprognosen eher nicht nach meinem Geschmack aussahen. Die Woche nahm ihren Lauf, einzelne Termine verflüchtigten sich, andere waren besser als gedacht, und das Wetter liess immer mal wieder die Sonne scheinen, so dass ich sogar draussen essen und schöne Spaziergänge unternehmen konnte.
Mach mal Pause – bewusst und mit Genuss. Ich neige dazu, viel zu wollen und auch zu tun. Und es fällt mir oft schwer, aus all den (teilweise auch selbst auferlegten) Pflichten auszubrechen und abzuschalten. Einfach mal ein Buch zum Spass lesen, wo ich noch so viele für einzelne Projekte zu lesen habe? Geht doch nicht… Doch dann machte ich es, ein dünnes Büchlein nur, ohne Ansprüche, ohne Ziel, ausser: Freude am Lesen. Es hat gut getan und ich war fast produktiver als sonst. Ich habe vermutlich nicht mal mehr pausiert als vorher, aber wohl bewusster und freudvoller, während ich vorher eher mal durchs Netz surfte, um ein wenig abzuschalten.
Ich und mein Tun sind nicht der Nabel der Welt. Ich las schon immer viele Biographien, hauptsächlich solche von Schriftstellern, einige auch von Malern. Immer wieder fiel mir auf, dass diese in ihrem Schaffen so grossartigen Menschen persönlich mit sehr schwierigen Charakteren ausgestattet waren, dass sie von sich selber und ihrem eigenen Schaffen eingenommen, anderen Menschen kaum Raum neben sich liessen. Das fiel mir auch im persönlichen Umgang mit Künstlern manchmal auf: Für manche gibt es nur sie und ihre Kunst als Thema. Ob das mit der Kunst kommt oder kommt die Kunst aus dem Naturell? Vielleicht ist es gar nicht auf die Kunst und die Künstler zu beschränken, sondern es gibt grundsätzlich Menschen mit dieser Eigenart, es gibt Menschen, die sich nur für sich interessieren und davon reden, und andere, die an einem wirklichen Dialog interessiert sind. Ich hoffe, ich verliere das selber nie aus den Augen.
Ein Zitat aus meinem letzten gelesenen Buch Françoise Dorner: Die letzte Liebe des Monsieur Armand) fand ich wunderschön und so wahr:
«Die heitere Kraft derer, die begriffen haben, dass selbsterobertes Glück die einzige gültige Antwort auf das anfängliche Unglück ist.»
Den Gedanke, dass auch unter schwierigen Umständen die Möglichkeit besteht, sein eigenes Glück zu suchen, finde ich sehr ermutigend und hoffnungsfroh.