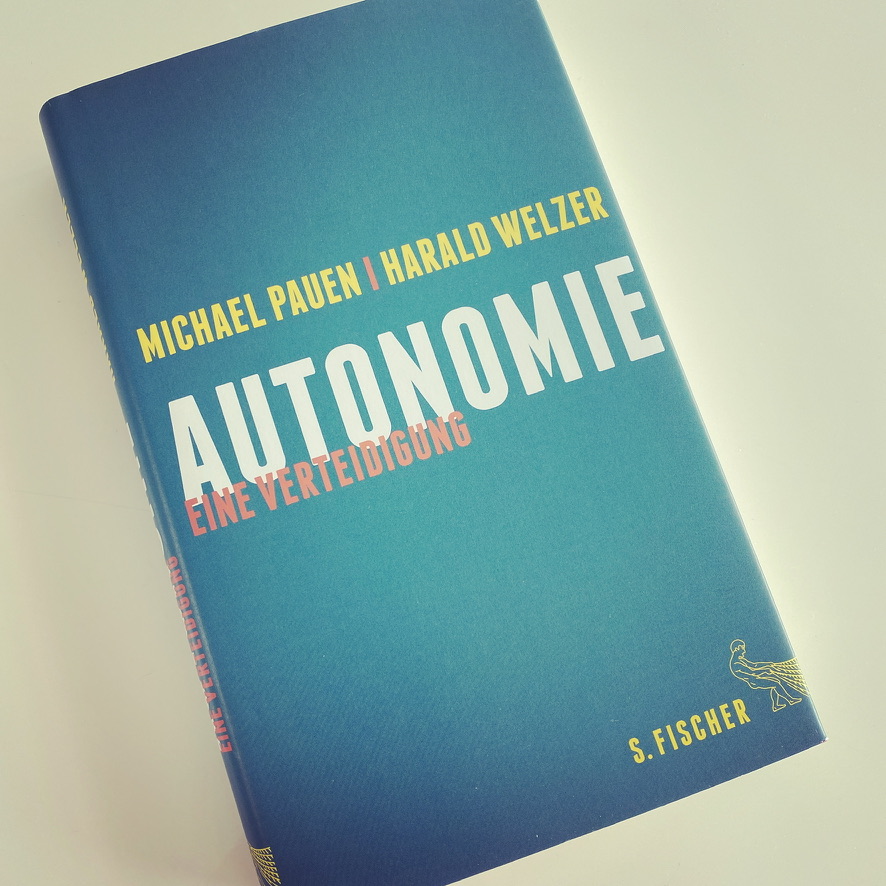„Der Sinn des Lebens ist einfach nur leben.“ (Alan Watts)
Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage beschäftigt die Menschen seit vielen Jahren, ja, Jahrtausenden. Wer nach dem Sinn fragt, fragt auch nach der Bedeutung, der Bedeutsamkeit von etwas. In diesem Fall bezieht sich die Frage auf das ganze Leben, sowohl das Leben an sich als auch auf des Lebens Sinn für den, der es lebt. Im ersten Fall geht es darum, dem Leben einen Gehalt zuzuschreiben, auch in Form einer Definition, einer Erklärung des Gegenstandes „Leben“ und dessen „Wozu“. Im zweiten Fall geht es mehr in Richtung Bedeutsamkeit, gemeint als Wert, Sinn, Geltung.
Schaut man auf das Wort selbst, steckt die Deutung drin. Das lässt darauf schliessen, dass das, was Bedeutung hat, jemanden braucht, der dies so deutet, der dem Ding eine Bedeutung zuschreibt. Das Mittelhochdeutsche „bediutunge“ ist denn auch so gemeint, als Interpretation, als Auslegung. Davon ausgehend steckt die Bedeutung also nicht im Ding selbst, sondern es ist eine Zuschreibung dessen, der darauf schaut. Das Leben an sich hätte so gesehen keinen Sinn an sich, wir geben ihm diesen dadurch, dass wir leben.
„Das Ziel des Lebens ist Selbstentfaltung. Seine eigene Natur vollkommen zu verwirklichen – dafür ist jeder von uns da.“ (Oscar Wilde)
Damit unser Leben für uns Sinn ergibt, Bedeutung hat, muss es unseren Werten entsprechen. Was ist für uns wichtig im Leben, wonach richten wir uns? Wenn wir es schaffen, das Leben so zu leben, dass es diesen, unseren Wert-Massstäben entspricht, blicken wir auf unser Leben als ein sinnvolles.
An dem Punkt sind wir aber nicht schon fertig mit der Suche nach dem sinnvollen Leben, hier fangen wir erst an, denn: Was sind unsere Werte? Wofür stehen wir ein? Wonach streben wir? Wonach richten wir uns? Was genau wollen wir im Leben? Mit dieser Frage fängt alles an. Schon Seneca wusste:
„Wer nicht den Hafen kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige.“
Die Frage nach dem Sinn des Lebens fängt also bei dir selber an. Du musst herausfinden, was für dich wichtig ist im Leben, deine Wünsche. Aufgrund derer kannst du dann deine Ziele definieren. Erst dann wirst du den Weg finden, der dahin führt, wo du hin willst. Nun ist das Leben aber selten ein Hüpfen von Ziel zu Ziel, sondern es besteht hauptsächlich durch den Weg von einem zum nächsten Ziel, welche quasi als Meilensteine das Leben zieren. So gesehen sind wir in unserem Leben hauptsächlich auf dem Weg, selten am Ziel – und wenn, dann nicht lange. Darauf verweist wohl auch der bekannte Spruch:
„Der Weg ist das Ziel.“
Nicht dass man auf dem Weg am Ziel oder der mit diesem identisch wäre, aber es ist das Ziel, den Weg so zu gestalten, dass er als erfüllend und gut und schön zu gehen erscheint. Ansonsten wird das Leben zu einem mühseligen Weg hin zu fernen Zielen, von denen man nie im Vornherein wissen kann, ob man sie wirklich erreicht und wie sich das Erreichen dann anfühlt. Ein solches Leben könnte kaum als schön gelten. Zwar meinte Nietzsche einst
„Wer ein Wofür im Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen.“
doch wir wissen, wohin das bei ihm geführt hat. Zwar ist das Wofür wichtig, weil richtungsweisend und dadurch durchaus sinnstiftend, doch ist auch das Wie massgeblich für die Lebensempfindung.
Was also können wir tun? Wie verleihen wir unserem Leben Sinn? Was brauchen wir dazu?
- Was ist dir wichtig im Leben? Welche Werte hältst du hoch? Finde heraus, was dir wirklich wichtig ist und was du nur von anderen übernommen hast oder denkst, tun zu müssen. Setze deine eigenen Massstäbe.
- Was sind deine Wünsche für dein Leben? Wo liegen deine Schwerpunkte? Lerne deine eigenen Träume kennen, setze deine eigenen Ziele.
- Wo sitzen deine Ängste? Ängste sind oft Stolpersteine, indem wir uns ausmalen, was alles Schlechtes passieren kann. Wie kannst du lernen, mit deinen Ängsten so umzugehen, dass sie dich nicht behindern?
- Wo liegen deine Stärken und Fähigkeiten? Wie kannst du sie am besten nutzen auf deinem Weg zu deinen Zielen? Brauchst du Hilfe auf deinem Weg zum Ziel? Wo kannst du sie kriegen?
- Wofür bist du schon dankbar im Leben? Der Blick auf das Gute im Leben gibt Kraft für neue Herausforderungen.
- Was macht dir wirklich Spass? Wo vergisst du dich und tust einfach, was du tust? Tätigkeiten, die uns Freude machen, zeigen uns oft, wo unsere Stärken liegen, wo wir uns wohl fühlen. Wenn wir auf unserem Weg möglichst viel davon einbauen können, wird nicht nur der Weg zum Ziel angenehm, unser ganzes Wohlbefinden steigert sich und das Leben zeigt sich als lebenswert. Was gäbe einem Leben mehr Sinn?
- Was sind die kleinen Schritte? Ziele erscheinen oft gross und dadurch schwer erreichbar. Sie in kleine Schritte zu unterteilen, von denen man jeden feiern kann, macht den Weg überschaubarer und weniger überwältigend.
- Wie stehst du hinter dir? Glaube an dich und dein Ziel. Was wir denken, formt unsere Gefühle. Positive Gefühle steuern unser Verhalten, fördern konstruktives Verhalten.
- Wie viel Schnauf hast du? Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, auch du brauchst Ausdauer, um ans Ziel zu kommen. Gib nicht gleich auf, wenn es mal harzig läuft. Erfolgsstrassen durchlaufen häufig Täler, häufig sind diese jedoch Schwellen zum nächsten Fortschritt.
- Du bist am Ziel, was nun? Nach dem Ziel ist vor dem Ziel. Höre nicht auf zu träumen. Nimm dein Leben in die Hand und fülle es mit Sinn.