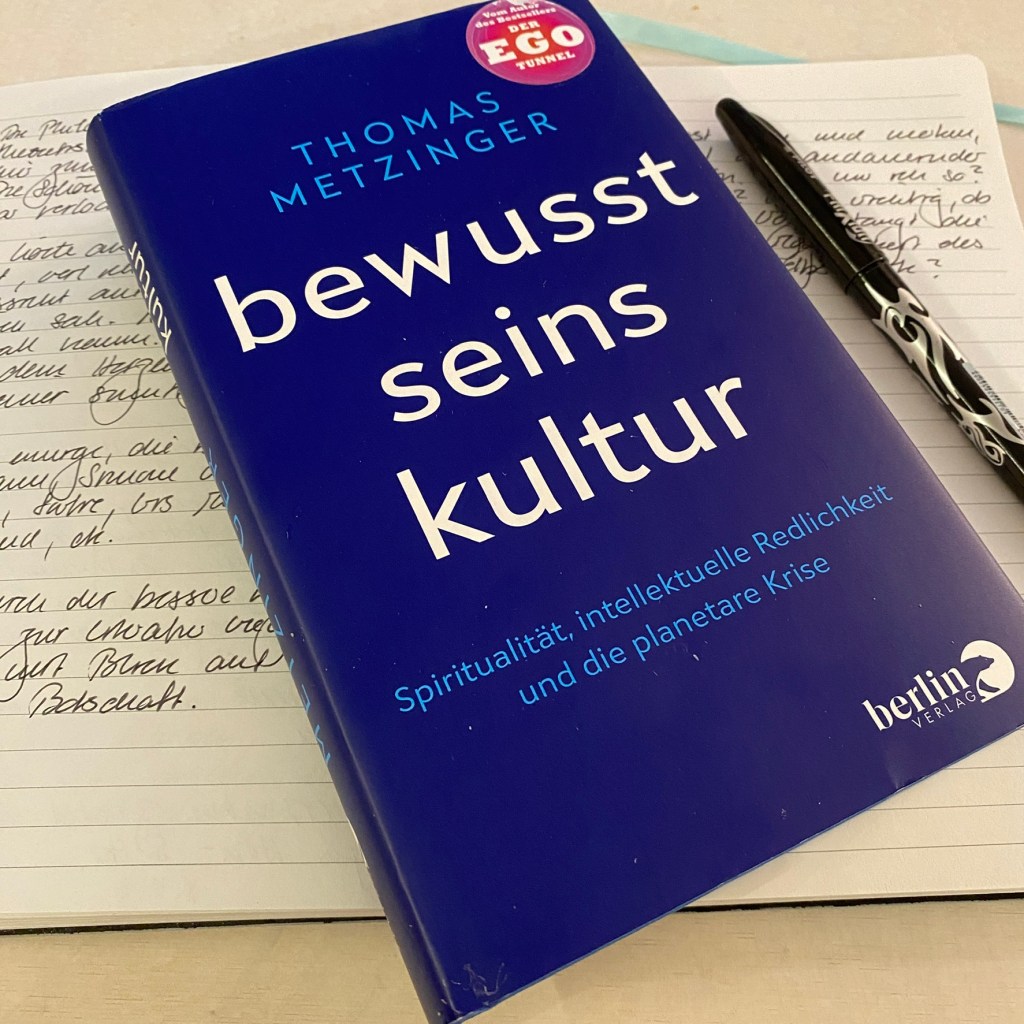Unsere Gesellschaft ist gespalten. Das hört man in der heutigen Zeit häufig und meistens werden als Grund dafür Corona und die deswegen vom Staat verhängten Massnahmen ins Feld geführt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses die Gründe für die Spaltung sind oder aber sie dieselbe, schon dagewesene, deutlich machten. Neu, davon bin ich überzeugt, ist diese Spaltung nicht, denn Spaltungen gab es immer, sowohl strukturell (arm-reich, das Patriarchat mit der Unterdrückung der Frau, etc.) wie auch in den Gesinnungen der Mitglieder der Gesellschaft. Sie teilen diese immer in zwei Lager: Dafür und dagegen.
Ich bin schon lange der Meinung, dass unser Verhalten einer Demokratie nicht würdig ist, dass wir mit unserer Art des Zusammenlebens die Demokratie gefährden und ad absurdum führen. Wenn man sich anschaut, was Demokratie bedeutet, ergibt sich folgende kurze Definition:
„Als demokratisch im weitesten Sinne bezeichnet man daher heute Machtverhältnisse, in denen Staatstätigkeiten (…) vom Volk durch die Wahl von Vertretern (Repräsentanten) und Vertreterkörperschaften ausgeübt wird, die auf mannigfache Weise (…) zustande kommen und verschieden zusammengesetzt sind. […] Demokratisch nennt man ferner innere Meinungsbildungsprozesse und Beschlussverfahren in Organisationen und Verbänden, zu welchen (analog zur demokratischen Staats- und Gemeindeverfassung) alle Mitglieder chancengleich Zugang haben und in denen sie gleichberechtigt mitwirken können.“ (Wörterbuch der philosophischen Begriffe)
Nun gibt es verschiedene Formen der Demokratie, welche ich hier nicht weiter behandeln möchte. Relevant für mein Thema hier ist nur noch, dass in einer Demokratie freie Menschen frei wählen können und bei solchen Wahlen das sogenannte Mehrheitsprinzip zum Tragen kommt. Das heisst: Bei demokratischen Entscheidungen gilt, was von der Mehrheit der Wählenden (verfassungskonform) bestimmt wird. Dass dies nicht immer befriedigend ist für die Minderheit, die den Entscheid mittragen muss, liegt auf der Hand. Was aber wäre die Alternative? In meinen Augen keine, welche die Vorzüge einer Demokratie behält und etwaige Problematiken beseitigen könnte.
«Die Majorität hat viele Herzen, aber ein Herz hat sie nicht.» Otto von Bismarck
Zentral für eine funktionierende Demokratie ist in meinen Augen ein funktionierender Austausch zwischen denen, welche die Entscheidungsgewalt haben. Nur so kann es gelingen, eine Lösung für Probleme zu erhalten, welche für die grösstmögliche Mehrheit stimmt und für die kleinstmögliche Minderheit trotz allem tragbar ist.
«Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf über die nächste Mahlzeit abstimmen.» Benjamin Franklin
Im Wissen darum, dass die überstimmte Minderheit die gefällten Entscheidungen mittragen muss, und in Anbetracht dessen, dass wir auch teilweise über Dinge entscheiden, die gerade die Minderheiten betreffen, ist es wichtig bei solchen Entscheidungen, dass die Minderheiten mit ihren Anliegen mitbedacht werden.
„Man ist gewöhnlich immer desto weniger republikanisch gesinnt, je höher der Rang ist, den man in der Welt bekleidet.» Georg Christoph Lichtenberg
Das Wissen um und das Ausnutzen der eigenen Übermacht ohne Rücksicht und Solidarität sind einer (als sozial verstandenen) Demokratie nicht angemessen. Da fangen die Probleme an, daran krankt in der heutigen Zeit die Demokratie:
Die Fronten sind verhärtet. Es scheint, als ob Menschen nicht mehr an einem Diskurs interessiert sind, als ob Dialektik ein vergessenes Gut und stures Beharren auf der je eigenen Sicht das einzige Anliegen ist. Andere Meinungen werden nicht mehr gehört, sie werden mit eigenen Argumenten in Grund und Boden gestampft. Nützt das nichts, wird der Anders-Denkende als Idiot bezeichnet und bevorzugt zum Schweigen gebracht – in den Sozialen Medien dadurch, dass man ihn ignoriert oder blockiert.
Ausgehend von meiner Hypothese, dass ohne Austausch keine (gelebte und gelingende) Demokratie möglich ist, bedeutet dies den Tod derselben. Wir müssen aber nicht mal in die Politik gehen, obwohl die Staatsform natürlich eine Sicherung der persönlichen Interessen einer Gesellschaft ausdrücken soll (im Idealfall) und damit natürlich relevant ist für den einzelnen Menschen. Schon die Gesellschaft ist eine grosse Gruppe, die oft zu abstrakt klingt. Wir leben darin, aber was ist sie konkret? Schauen wir uns also das Problem im kleineren Rahmen an: Wie gehen wir mit Menschen um, die anders denken? Hören wir uns an, was sie zu sagen haben, wie sie zu ihrer Meinung kommen? Können wir ihre Meinung auch einmal stehen lassen und akzeptieren, dass wir in gewissen Punkten nicht einer Meinung sind? Oder stimmt für uns ein Miteinander nur, wenn einer den anderen überzeugt hat (bevorzugt wir den Anderen)? Die Vehemenz, mit welcher heute Diskussionen ausgefochten (die Kriegsmetaphorik ist bewusst gewählt) werden, besorgt mich.
«Die Demokratie ist die edelste Form, in der eine Nation zugrundegehen kann.» Heimito von Doderer
Was mich ebenso besorgt, ist, dass in solchen Diskussionen nicht nur nicht genau hingehört wird, sondern die Gegenargumente oft auch aus dem Zusammenhang gerissen, falsch wiedergegeben werden und der sie Äussernde durch solche Fehlzuschreibungen verunglimpft wird. Es ist gut und wichtig, eine Meinung zu haben, und eine Meinung muss auch vertreten werden, schliesslich steckt eine Überzeugung dahinter. Was ich aber vermisse, ist die Einsicht, dass wohl keiner allein in jedem Fall immer die ganze Wahrheit sieht oder alles wissen kann. Wer glaubt, Wahrheit erkenne man nur von einem (dem eigenen) Standpunkt heraus, muss auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist – oder hat er die Krümmung gesehen von da, wo er steht? Hinzuhören, wie man etwas auch noch anders sehen kann, oder wie es von einer anderen Warte aus gesehen wird, kann helfen, den eigenen Blick zu weiten. Das kann dazu führen, dass man merkt, dass die eigene Sicht richtig war, weil man im Gedanken des Anderen einen Denkfehler findet, es kann dazu führen, die eigene Sicht zu revidieren oder anzupassen, weil man merkt, dass man etwas nicht bedacht hat, oder es kann zu einer gemeinsamen neuen Meinung führen, welche mehr ist als nur die Summe ihrer Teile, sondern ein ganzheitlicherer Blick auf eine Welt, die so komplex ist, dass einer allein sie kaum je wird erfassen können.
Wenn wir das nun auf die Demokratie anwenden und darauf, wie Menschen, die diese gestalten sollen, agieren müssten, komme ich zu dem Schluss: Es wird uns nur gemeinsam gelingen, die Welt so zu schaffen, dass sie für all die, welche sie bewohnen müssen, eine gute Welt ist, in welcher jeder sich nach seinen Fähigkeiten als Gleichberechtigter entwickeln kann und die Chance hat, zu partizipieren. Dazu bedarf es eines offenen Dialogs unter als gleichwertig Anerkannten, die man als mit sich verbunden sieht, weil sie wie man selber auch, in eine Welt geworfen wurden, die sie sich nicht ausgesucht haben, in welcher sie nun aber ein gelingendes Leben leben möchten.