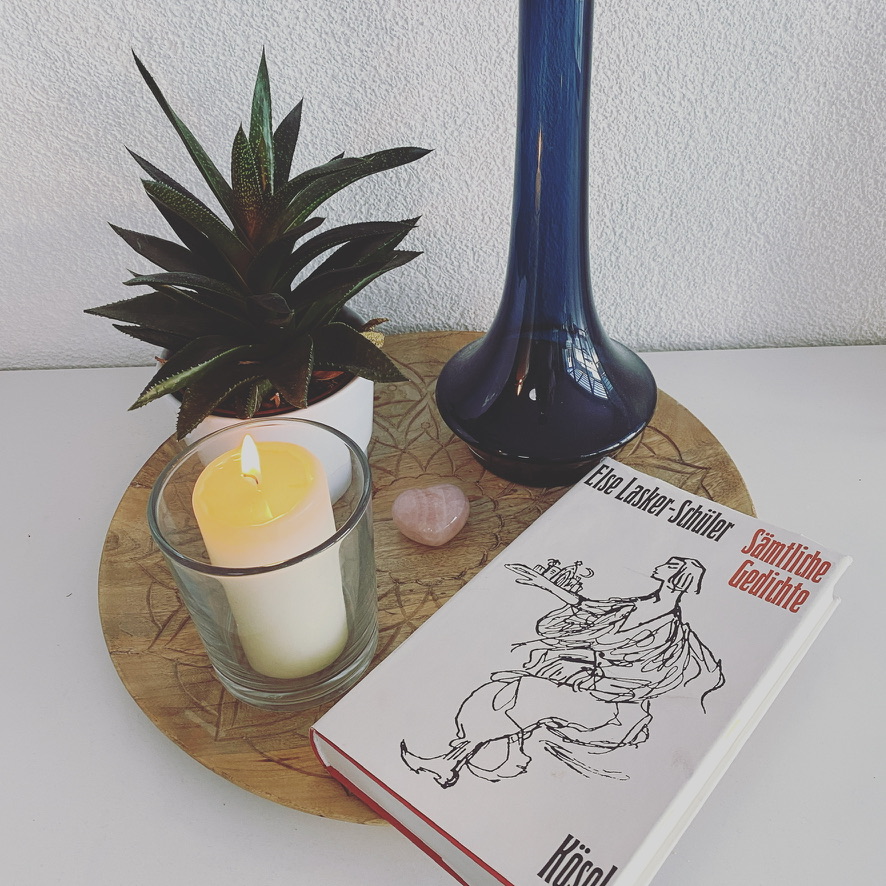«Der Eremit
Sie warfen nach ihm mit Steinen.
Er lächelte mitten im Schmerz.
Er wollte nur sein, nicht scheinen.
Es sah ihm keiner ins Herz.
Es hörte ihn keiner weinen,
Er zog in die Wüste hinaus.
Sie warfen nach ihm mit Steinen.
Er baute aus ihnen sein Haus.»[1]
(Mascha Kaleko)
Wir sind als Menschen soziale Wesen, wir sind abhängig voneinander, da wir allein nicht überlebensfähig sind – dies nicht nur im körperlichen, sondern vor allem auch im psychischen Sinn. Die Seele leidet, wenn man sich nicht akzeptiert fühlt. Die Welt scheint fern und fremd, wenn man sich in ihr nicht zu Hause fühlt. Zu Hause fühlt man sich da, wo man sich angenommen fühlt, wo man sein darf, wer man ist, wo man spürt: Ich gehöre dazu, ich bin so akzeptiert, wie ich bin.
Ich kann mir zwar wünschen, dass mich andere Menschen als die nehmen, die ich bin – selbst, wenn ich anders bin als sie. Erwarten kann ich es leider nicht, verlangen schon gar nicht. Was, wenn die Anerkennung ausbleibt? Wenn ich mich ausgestossen fühle aus der Gemeinschaft, weil ich in den Augen anderer nicht hineinpasse? Muss oder kann ich mich so sehr verbiegen, dass ich passend werde? Würden sie mich dann mögen? Wäre ich dann zufrieden? Aber: Wen würden sie dann eigentlich mögen? Wäre das noch ich?
Oder muss ich meine Koffer packen und gehen? In der Hoffnung, Menschen zu finden, die mich so verstehen und annehmen können, wie ich bin? Nur: Das werden wohl nirgends alle sein. Wie viele braucht es, um mich akzeptiert zu fühlen, und mit wie viel Ablehnung und Ausgrenzung kann ich umgehen? Kann ich an dieser auch wachsen? Indem ich mir einen Schutz aufbaue, wie der Eremit in Mascha Kalékos Gedicht sein Haus? Oder maure ich mich dann ein und werde unberührbar, damit unfähig, noch wirkliche Begegnungen zu haben, Beziehungen zu leben?
Du bist, wie du bist und du bist nicht genehm
Du bist, wer du bist, und du wirst nicht geseh’n.
Du wirst ausgemessen und sorgsam geprüft,
man schaut nur von aussen, mehr will man nicht seh’n.
Das reicht schon zu wissen, ob du wirklich passt.
Du denkst dir nichts Böses, du möchtest nur sein.
Und merkst ganz tief drin, ich gehör’ hier nicht rein.
Du fühlst dich alleine, verlassen und leer.
Du fühlst dich verloren, und möchtest weggeh’n.
Du stellst dir die Frage: «Wo soll ich nur hin?
Wo ist der Ort bloss, für mich, wie ich bin?»
Allen werde ich nie gefallen, danach zu streben hiesse, mich immer wieder selbst zu verletzen durch falsche Hoffnungen und Erwartungen und die darauffolgenden Enttäuschungen. Schlussendlich wird es auch nicht gelingen, mich auf Dauer zu verbiegen, denn das eigene Gefühl, nicht sein zu können, wer ich eigentlich bin, untergräbt die Freude an der Beziehung mit anderen, es ist ein zu grosser Preis: Ich gehöre nur dazu, weil ich bin, wie sie mich haben wollen, nicht weil ich bin, wer ich bin.
Es bleibt wohl nur eines: Ich muss mir immer wieder klar werden, wer ich bin und was ich will und brauche im Leben und von anderen Menschen. Und dann muss ich sehen, ob ich das in solcher Form kriege an dem Ort, wo ich bin, oder ob ich vielleicht am falschen Platz bin. Dann müsse ich mir einen suchen, der besser passt. Vielleicht reichen aber auch kleine Anpassungen aus, um einen Ort zu einem passenden zu machen. Vielleicht muss ich kein Haus bauen, nicht mal Mauern errichten, es reicht vielleicht ein Schutzschild, den ich hochhalten kann. Ein Schutzschild, hinter das ich in unsicheren Momenten treten kann und hinter dem das warme Gefühl aufkommt: Ich bin, wie ich bin, und das ist gut so. Und dann trete ich wieder hervor und schaue, ob das auch noch andere finden. Und wenn ich mich auf die konzentriere, statt immer jene im Blick zu haben, die mich ablehnen, stehe ich plötzlich in einer Welt, in der ich mich wohlfühlen kann.
[1] Zit. Nach «In meinen Träumen läutet es Sturm» ©1977 dtv Verlagsgesellschaft mbH&Co.KG, München