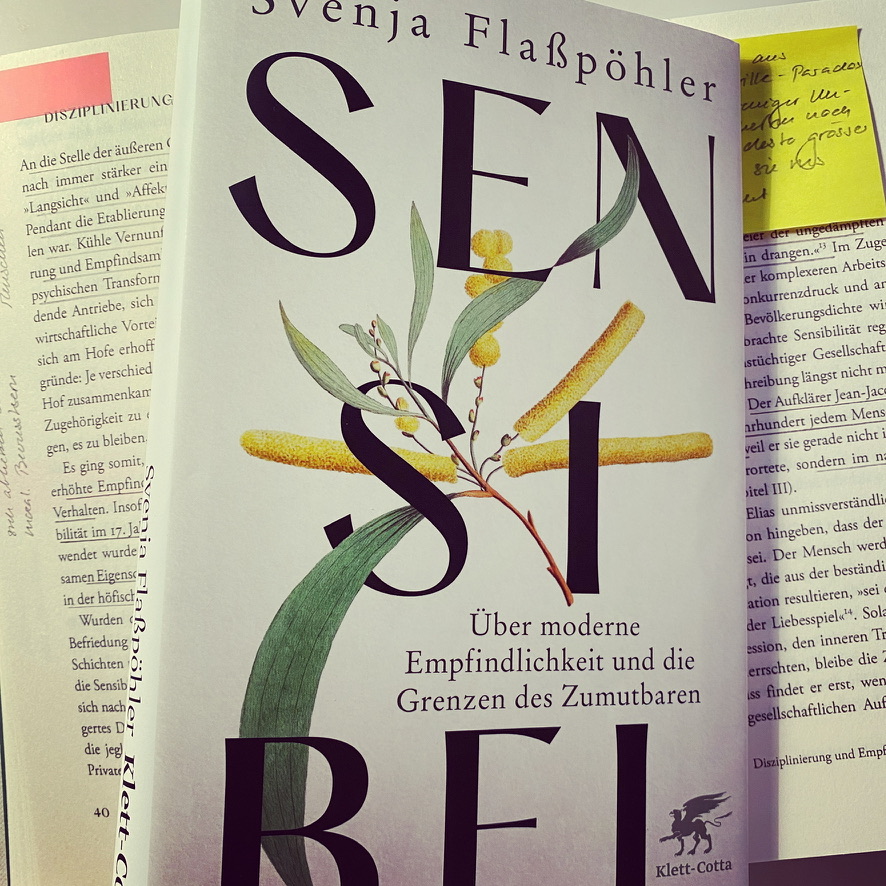Warum Liebe politisch ist
Inhalt
„Ich schreibe, weil mich die Welt zutiefst beunruhigt. Buchstaben machen die Unruhe für mich fassbar. Und ich schreibe, weil ich Veränderung will.“
Wer glaubt, dass Liebe Privatsache ist, täuscht sich gewaltig. Liebe findet nicht im luftleeren Raum statt, Liebende sind keine unbeschriebenen Blätter. Durch die kulturelle und gesellschaftliche Prägung haben wir alle Muster und Bilder verinnerlicht, die wir in unsere Liebe, in unser Begehren hineintragen. Wen wir begehren oder begehren dürfen, ist oft von ganz vielem gesteuert. Und wehe, wenn unser Lieben nicht dem entspricht, was der gesellschaftlichen Norm entspricht, dann sind wir in Gefahr, Diskriminierung und Gewalt zu erleben.
Seyda Kurt erzählt einerseits ihre eigene Geschichte mit den lange verinnerlichten Mustern, die es für sie zu durchbrechen galt. Andererseits beleuchtet sie die althergebrachten Beziehungsmodelle und plädiert für einen Bruch mit diesen, um eine gerechtere Gesellschaft ohne Diskriminierungen zu schaffen.
Weitere Betrachtungen
„Strukturelle Privilegien legen sich gleichsam wie eine Schutzschale um manche Körper und bewahren sie davor, gewisse Formen der Gewalt zu erfahren.“
Wer der gängigen Norm entspricht, lebt in einer sehr privilegierten Welt, in welcher er von Gewalt, Abwertung und Diskriminierung verschont ist. Oft sind wir uns dessen nicht bewusst und tragen sogar noch dazu bei, diese toxischen Strukturen aufrecht zu erhalten. Seyda Kurt zeigt auf, inwiefern die landläufig als normal angesehene monogame, heterosexuelle Beziehung sich als Normalität in unseren Köpfen und in unserem Begehren eingenistet hat, und sie ruft dazu auf, damit zu brechen.
Die aktuell sehr breit vertretene Auffassung, dass eine offene Beziehung, mehrere Partner und homosexuelle Erotik die freie und wirklich gefühlte Form sei, die monogame heterosexuelle nur alten Mustern und Zwängen aufsitzt, hat auch in diesem Buch wieder eine Vertreterin. Es mutet dabei komisch an, in einem Plädoyer für mehr Offenheit und Toleranz auf die Verurteilung des von der Autorin als nicht mehr der Zeit entsprechenden Beziehungsmodells zu stossen. Ich bin durchaus der Meinung, dass jeder auf seine Weise den von ihm gewünschten Menschen (oder auch mehrere) lieben soll, nur sollte das alle Formen beinhalten, auch die monogame heterosexuelle, die nicht immer nur auf Mustern, nicht wahrem Begehren fusst.
„Jemand kann dich lieben und dich gleichzeitig unterdrücken, dich nicht beachten, wenn du deine Stimme erhebst. Es ist Zeitverschwendung, immer auf die Liebe zu verweisen. Stattdessen müssen wir auf die ungleiche Verteilung von Macht verweisen, die hierarchischen Strukturen auflösen, in denen die einen immer unten und die anderen immer oben stehen.“
Es gibt immer wieder Stimmen, welche die Liebe allmächtig sehen. Wenn nur die Liebe da ist, wird alles gut. Leider ist das zu kurz gedacht. Auch in Liebesbeziehungen kann es zu Gewalt kommen, auch in Liebesbeziehungen können Hierarchien existieren, auch in Liebesbeziehungen kann einer unterdrückt werden. Dies muss nicht aus mangelnder Liebe oder Boshaftigkeit geschehen, es können auch tief verinnerlichte Muster und Veranlagungen Auslöser von all dem sein. Oft passiert ganz viel davon unbewusst, wird von beiden (allen) Beteiligten nicht wahrgenommen. Dagegen können wir nur angehen, wenn wir uns dieser Möglichkeiten bewusster werden, wenn wir hinschauen, wie und was wir eigentlich leben, und uns immer auch fragen, ob wir das so wirklich wollen oder aber nur hinnehmen, weil es „normal“ ist, oder wir nicht wüssten, wie wir es anders haben könnten.
„Ich kann und will Diskriminierungen nicht gegeneinander aufrechnen… Privilegien sind oft formbar, anpassungsfähig, mehrdeutig. Sie sind nicht universell. Ihre politische Wirkkraft ist stark gekoppelt an Kontexte und historische Gegebenheiten.“
Es gibt verschiedene Gründe für Diskriminierung: Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexuelle Ausrichtung, etc. Sie wirken sich in verschiedenen Situationen verschieden aus. Oft treten sie auch kombiniert auf. Hierarchien zu schaffen, welches die am schlimmsten betroffenen Opfer seien, dient der Sache nicht, da sie nur Spaltung unter den Opfern provoziert, statt diese zu vereinen im gemeinsamen Kampf gegen Diskriminierung auf allen Ebenen. Intersektionalität ist gefragt, nicht Hierarchie oder neue Formen des Ausschlusses.
Persönlicher Bezug
„Je konkreter ich meine Bedürfnisse formuliere, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich und andere Menschen sie befriedigen können. Desto verständlicher mache ich für mich und andere Menschen Verletzungen, an denen ich leide. Vielleicht hilft es mir zu heilen.“
Ich neige dazu, meine Bedürfnisse hintenan zu stellen und schweigend die anderen zu erfüllen. Ich merke zwar, dass ich innerlich ab und zu damit an Grenzen stosse, doch es fällt mir schwer, das zu durchbrechen, da ich ja genügen möchte, es den anderen recht machen möchte. Auf Dauer geht das selten gut, die eigene Unzufriedenheit wächst, weil man sich nicht gesehen fühlt, weil man zu kurz kommt. Und irgendwann ist auch das Fass voll und es kommt zu einer Reaktion, die aus dem Anstau von unbefriedigten Bedürfnissen resultiert und in der aktuellen Situation nicht angemessen ist.
„Doch gerade im Kontext romantischer Liebe habe ich oft Angst, konkret zu werden. Denn je konkreter ich formuliere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Bedürfnisse jenen anderer Menschen widersprechen. Dass ich vielleicht verurteilt werde.“
Schweigen aus Angst, abgelehnt zu werden – das ist der sicherste Weg ins Unglück. Und doch erscheint es oft als einfachster Weg.
Für mich hat das Buch ein paar interessante Einblicke gewährt, ein paar Denkanstösse gegeben, es brachte aber wenig Neues (Bücher rund um die Themen boomen grad, ich habe ja einige besprochen in der letzten Zeit, und sie erzählen alle in etwa das gleiche) und war mir teilweise zu sehr auf neue Beziehungsformen ausgerichtet und zu verallgemeinernd ablehnend gegenüber anderen.
Fazit
Ein gut lesbares Buch über die Liebe, Liebesformen und die Bedeutung von gesellschaftlichen Strukturen für dieselbe.
Autorin
Şeyda Kurt, geboren 1992 in Köln, studierte Philosophie, Romanistik und Kulturjournalismus in Köln, Bordeaux und Berlin und ist Journalistin und Moderatorin. Sie schreibt unter anderem für taz. Die Tageszeitung und ZEIT ONLINE. In der Kolumne Utopia bespricht sie für das Theater-Onlinemagazin nachtkritik.de kulturelle Repräsentationen von Liebe und Zärtlichkeit auf Theaterbühnen. Auf Twitter schreibt sie unter @kurtsarbeit über politische und soziologische Belange.
Angaben zum Buch
Herausgeber: HarperCollins; 7. Edition (20. April 2021)
Taschenbuch: 224 Seiten
ISBN-Nr.: 978-3749901142