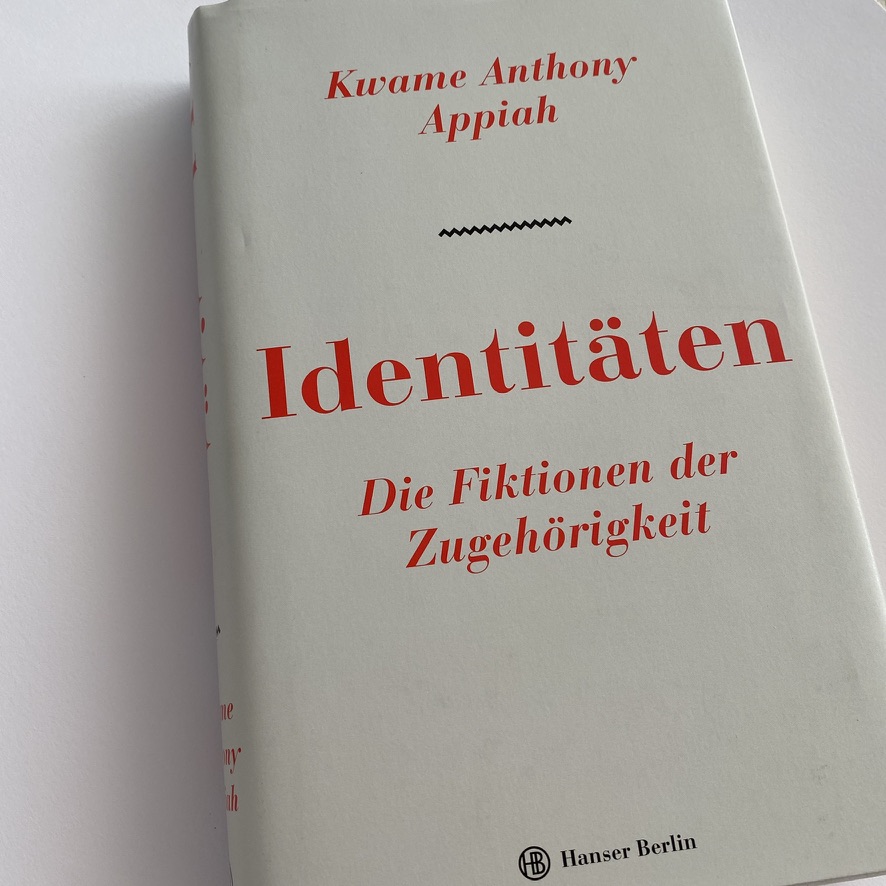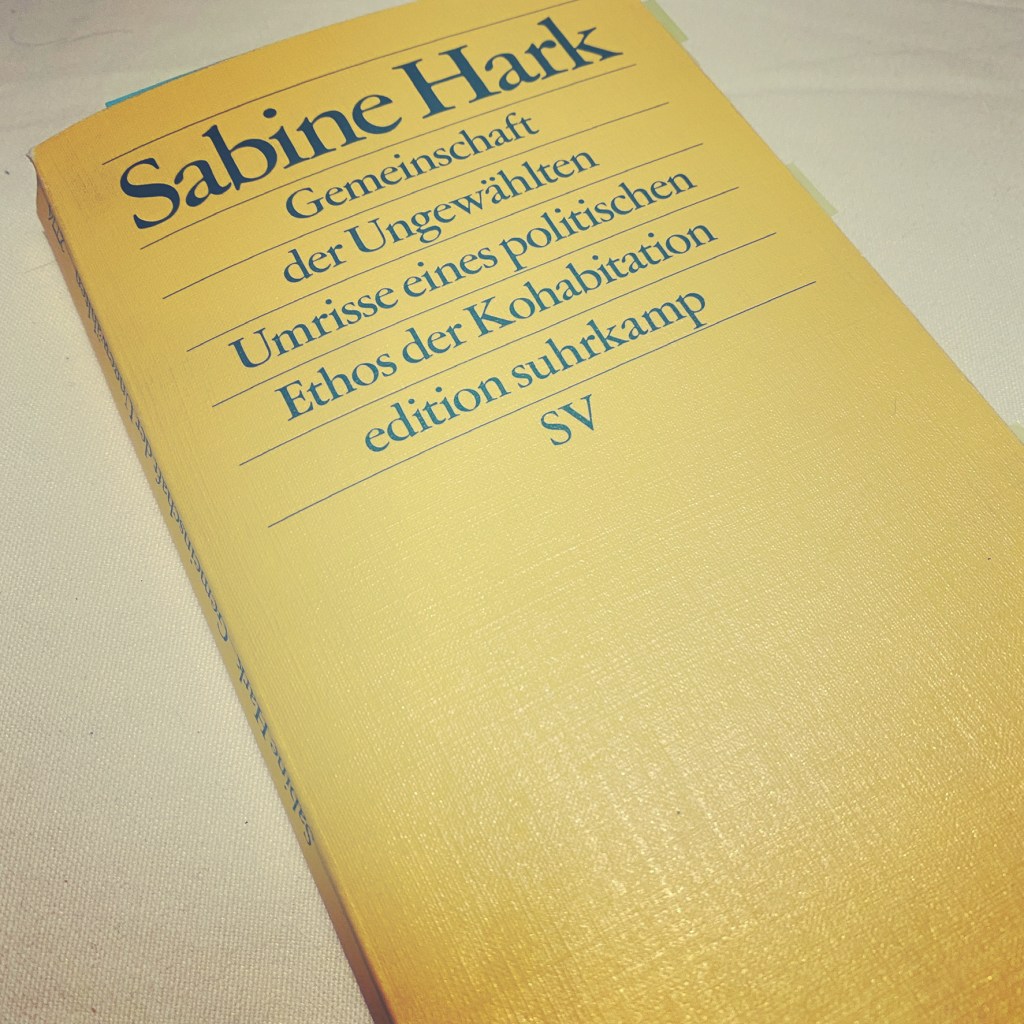«Die Aufgabe ist, dass der Mensch so lebt, dass der Zweck, das Ziel seines Lebens die volle Entfaltung aller seiner Kräfte ist als ein Selbstzweck und nicht als Mittel zur Erreichung anderer Zwecke.» (Erich Fromm, Marx zitierend)
Das sagte Erich Fromm in einem Interview und meinte es als Kritik an einer Welt, die Menschen immer mehr als Ressourcen sieht, und immer weniger als Personen, als Individuen. Was zählt, ist das Haben, der Profit, dabei geht das Sein, das Leben als ganzer Mensch, unter. Sinnbildlich wird das in Firmen, in denen die Personalbüros «Human Ressources» heissen: Menschliches Kapital quasi, ein Gut, auf das man für den Profit strategisch zurückgreift. Kein schönes Bild, wie ich finde. Kein Wunder, fühlen sich Menschen immer unwohler in der Arbeitswelt, brennen sie aus, werden sie krank. Für die ressourcenorientierte Gesellschaft ist das kein Problem, jeder ist ersetzbar, fällt einer aus, kommt der nächste.
Das fängt aber schon früher an: Auch in der Schule zeigt sich diese Haltung. Es geht nicht um Bildung, sondern um Wissensanhäufung unter Zwang und Leistungsdruck. «Und bist du nicht willig, dann kriegst du ne eins (in der Schweiz die schlechteste Note).» Wer es nicht aufs Gymnasium schafft, hat je länger je mehr ein Problem, die Berufsauswahl schrumpft. Es zählt nur noch, was einer (an Papieren) hat, nicht was er an wirklichen Fähigkeiten mitbringt. Eine Kindergartenlehrerin muss in Mathe gut sein, die Sozialkompetenz, der liebevolle Umgang mit Kindern sind keine ausschlaggebenden Kriterien.
Was so mehr und mehr wegfällt, ist eine wirkliche Beziehung zwischen Menschen, eine wirkliche Beziehung zur Welt. Der Mensch sieht sich als Rad im Getriebe und fühlt sich nicht gesehen. Das Interesse liegt mehrheitlich darauf, was einer hat, nicht wer er ist. Dadurch entstehen keine wirklichen Beziehungen, doch die wären wichtig für den Menschen, denn ohne sie kann er nicht als Mensch wirklich existieren, sicher kann er kein Leben führen, das ihn befriedigt, das er als gutes Leben bezeichnen würde. Es kommt zu einer immer grösseren Entfremdung – von der Welt, von anderen Menschen, oft auch von sich selbst.
Vielleicht wäre es langsam an der Zeit, umzudenken, Leben neu zu denken – weg von
«Sag mir, was du hast, und ich sage dir, wer du bist.»
Hin zu
«Sag mir, was du fühlst, denkst, tust und willst, und ich sehe, wer du bist.»
Das könnte ein Weg sein weg von profitorientierter Existenz hin zu einem sinnerfüllten Leben.