Was ist mir diese Woche begegnet, hat mich diese Woche inspiriert?
- Wenn man mich fragt, was ich so in meiner Freizeit mache (wobei sich bei mir Frei- und Arbeitszeit ziemlich deckungsgleich überscheiden), sage ich oft: Nichts. Und ich meine damit, dass ich nicht machte, was ich mir vorgenommen habe. Oft setzte ich mich hin, fing mit etwas an, wurde davon zu etwas inspiriert, ging ins Netz, recherchierte, und ich kam von einem zum anderen… und Zeit verging. Angefühlt hat es sich schlussendlich nach nichts. Aber: Ich habe gelernt. Das merkte ich kürzlich, als ein Thema aufkam. Und genau dem habe ich hinterhergeforscht. Ich habe unglaublich viel schon gelernt auf die Weise. Wenn ich schlicht bei Facebook hängen bleibe, ist das sicher nicht dasselbe, aber: Das Netz hat viel zu bieten. Wenn man mit einer Portion Neugier reinsticht, wird man immer mit einem Lerneffekt rauskommen.
- Kürzlich brauchte ich ein Foto für einen Artikel, auf die Schnelle kam mir nichts anderes in den Sinn, als schnell das Gesicht eines Autors zu zeichnen und es dann abzulichten. Ich schimpfe ab und an mit mir, dass ich zu viel spannend finde und mich ab und an verzettle, weil ich vom Einen zum Anderen fliege… unter anderem flog ich auch mal zum Zeichnen und Malen. Ich wollte das unter den Teppich kehren, nie mehr erwähnt wissen, schliesslich bin ich ein schreibender Mensch. Und man muss sich ja auch mal entscheiden. Doch plötzlich war ich dankbar, konnte ich einfach mit ein paar Strichen ein Gesicht zeichnen… Alles, was in einem ist, gehört zu einem. Und es darf seinen Platz haben. Nur so wird man selber zu einem Ganzen.
- Da war so dieser Lockdown. Und ja, mir fehlte wenig, einiges so ein bisschen, aber es ging gut. Und immer wieder kam der neue Entscheid, alles wurde weitergeführt, auch wenn gewisse Öffnungen wünschenswert gewesen wären. So rein persönlich. Das ohne Klagen, es ging auch so wirklich gut. Und dann… einmal hätte eine Nicht-Öffnung etwas Positives gebracht für mich. Just da wurde geöffnet. Und ich sass da und war ein wenig frustriert. Es wäre nicht nötig gewesen. Aber es war ein Lehrplatz: Es bringt nichts, sich über Dinge aufzuregen, die nicht in der eigenen Hand liegen. Es ist auch so gut. Wenn ich es selber als gut ansehe und etwas Gutes draus mache.
Ich kann nicht die Welt ändern, ich habe es nur in der Hand, wie ich auf diese reagiere.
- Ich nehme mir gerne Projekte vor. Weil sie mich anspringen und begeistern. Und dann merke ich über die Zeit, dass sie doch schwierig werden. Und ich frage mich: Soll ich daran festhalten, da ich es mir schlicht vorgenommen habe? Oder darf ich auch Anpassungen vornehmen? Oder gar mal ein Projekt beerdigen, weil es schlicht seine Zeit hatte und für mehr nicht genug da war – wovon auch immer. Ein solches Projekt sind diese Inspirationen. Ich schaue und höre und lese viel in der Woche. Und denke drüber nach. Vieles ist inspirierend. Und bei vielem denke ich dann, dass das aber zu wenig allgemein relevant wäre, es reinzustellen. Und vermutlich ist auch das, was ich schlussendlich wähle, eher subjektiv und einer persönlichen Momentaufnahme geschuldet. Es stellt sich die Frage: Zieh ich es so weiter? Höre ich auf? Lockere ich die Vorgaben an Menge und Regelmässigkeit? Ich habe noch keine Antwort.
- Zum Abschluss möchte ich ein Gedicht von Hilde Domin zitieren, einer Lyrikerin, die mich mit ihrer Lebensgeschichte, ihrer Haltung zu ihrem Schicksal und ihrem Einsatz für die Lyrik immer wieder beeindruckt:
«Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.»
Mögen wir an die Wunder dieser Welt und dieses Lebens glauben, egal, was uns begegnet.
Ich hoffe, es war was für euch dabei, das euch angesprochen hat. Wenn ihr etwas habt, das euch diese Woche angesprochen, bewegt, inspiriert hat – ich würde mich freuen, wenn ihr davon berichten würdet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche!




 Franziska zu Reventlow wird am 18. Mai 1871 im Schloss Husum geboren. Fanny erfährt eine strenge Erziehung, teils durch die Familie, teils durch das Altenburger Magdalenenstift, ein Mädchenpensionat in Thüringen. Schon früh zeigt sich ihr rebellisches Wesen, welches nach nur einem Jahr in der Pension zu ihrem Rauswurf führt. Es folgt ein privates Lehrerinnenseminar, eine nicht wirklich typische Ausbildung für eine junge Adlige.
Franziska zu Reventlow wird am 18. Mai 1871 im Schloss Husum geboren. Fanny erfährt eine strenge Erziehung, teils durch die Familie, teils durch das Altenburger Magdalenenstift, ein Mädchenpensionat in Thüringen. Schon früh zeigt sich ihr rebellisches Wesen, welches nach nur einem Jahr in der Pension zu ihrem Rauswurf führt. Es folgt ein privates Lehrerinnenseminar, eine nicht wirklich typische Ausbildung für eine junge Adlige.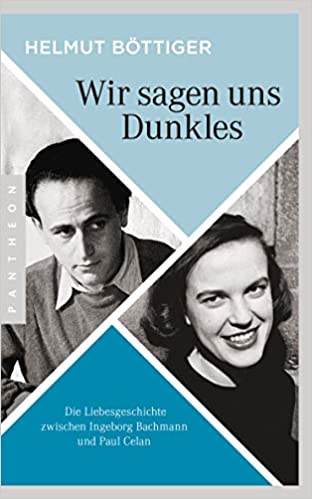
 Trotzdem hält er am Studium fest und die Medizin bleibt lange seine Haupttätigkeit. Nach einer Assistenzstelle im Allgemeinen Krankhaus der Stadt Wien wird er Assistent seines Vaters, publiziert in der Zeit mehrheitlich Fachartikel. Daneben pflegt er aber Freundschaften zu den Schriftstellern seiner Zeit, darunter Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal und weitere der literarischen Wiener Moderne.
Trotzdem hält er am Studium fest und die Medizin bleibt lange seine Haupttätigkeit. Nach einer Assistenzstelle im Allgemeinen Krankhaus der Stadt Wien wird er Assistent seines Vaters, publiziert in der Zeit mehrheitlich Fachartikel. Daneben pflegt er aber Freundschaften zu den Schriftstellern seiner Zeit, darunter Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal und weitere der literarischen Wiener Moderne.