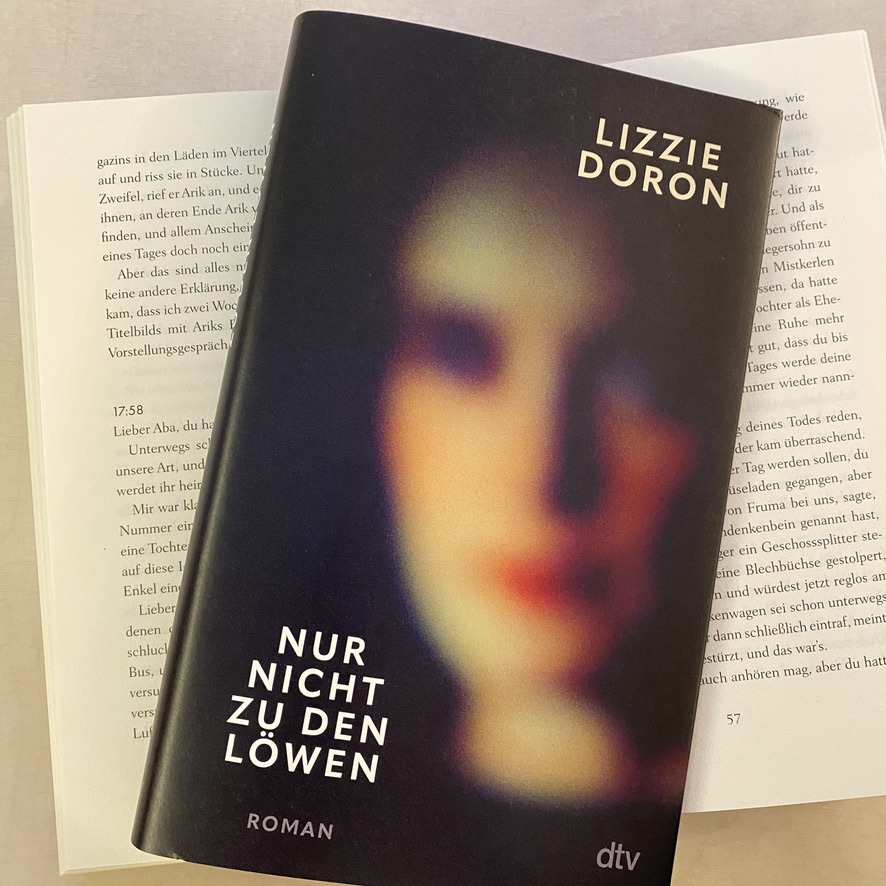Lieber Papa
Ich musste zu dir. So schnell wie möglich. Um 7 Uhr stehe ich an der Bushaltestelle. In meiner Tasche ein Buch, ein Notizbuch und in mir angespannte Unsicherheit und Nervosität. Was erwartet mich? Wie treffe ich dich an? Normalerweise sitze ich um diese Zeit zu Hause an meinem Pult und schreibe die ersten Zeilen des Tages oder kümmere mich um Administratives. Bislang dachte ich, das seien die schlechten Tage, solche, an denen mir nichts einfallen will. Da merkte ich, dass auch das gute Tage sind, denn ein wirklich schlechter Tag war heute. Nun ging es nicht um Schreiben oder nicht Schreiben, nun ging es um dich.
Ich ging nicht allein auf Reisen, an der Bushaltestelle standen viele Leute, vermutlich auf dem Weg zur Arbeit. Sie schienen geübter im Stehen und Warten. Eine Routine, die ich nie gekannt hatte im Leben, da ich mich immer auf eigenen Wegen und im eigenen Rhythmus durchs Leben bewegt habe. Die anderen grüssen einander, nicken sich zu. Alte Bekannte der täglichen stummen Begegnung, ein «auch wieder da» im Blick. Nicht als Frage, sondern als Bestätigung des gewohnten Alltags. Das, was bei mir gerade aus den Angeln gehoben worden war.
Dann sass ich im Bus und schaute raus. Mein Blick erfasste nichts. Fand keinen Halt. Er ging durch die Dinge hindurch ins Leere. Was dachte ich? Was fühlte ich? Ich konnte es nicht fassen. Es war un-fassbar. Und ich fassungslos.
Am Hauptbahnhof stieg ich aus, konnte mich mit dem Menschenstrom treibenlassen, war mitgenommen. Überall so viel Leben. Und dessen Ende als dunkle Angst in mir. Ich fühlte mich wie eine einsame Insel in einem wogenden Ozean. Ein Gefühl, das mir auch sonst nicht fremd ist.
Als ich den Zug bestieg, waren erst wenige Plätze besetzt. Die noch freien füllten sich langsam. Später würde ich wissen, dass hier jeder seinen Platz hat. Dann würde auch ich meinen haben. Ich packte mein Buch und mein Notizbuch aus, legte es vor mir auf den Tisch. Das sah aus, als ob ich viel vor hätte. Wie dieser Schriftsteller, der morgens in den Zug steigt und dann schreibend durch die Schweiz fährt. Ich schrieb nicht.Ich fuhr zu dir. An dem Tag wusste ich noch nicht, dass ich einige Jahre weder lesen noch schreiben können würde. Als hätte Mamas Anruf dem einen Riegel vorgeschoben.
Irgendwann stand ich vor deiner Zimmertür. Beim Gehen durch die Gänge war ich immer langsamer geworden. Als ob das Hinausschieben helfen könnte. Oder alles nicht wahr sei, wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen würde. Ich klopfte leise. Öffnete vorsichtig die Tür. Linste durch den Spalt. Sah dich da liegen. Du drehtest deinen Kopf zu mir und lächeltest mich an. Wie müde du aussahst. Die Arme seltsam mager. In meiner Erinnerung waren sie kräftig. Mit zupackenden Händen.
«Hallo Papa»
Im Zug schwirrten mir so viele Gedanken und Fragen durch den Kopf. Nun kam mir nichts mehr in den Sinn. Passte nicht. Kam mir zu aufdringlich vor. Oder hatte ich Angst, auf die Fragen Antworten zu kriegen, die ich nicht hören wollte? Das war sonst eigentlich deine Taktik. Ich fand sie plötzlich gut.
«Wie fühlst du dich?»
«Eigentlich gut.»
Klar, drum lagst du da. Aber ja, ich hatte gefragt.
«Konntest du schon mit den Ärzten sprechen? Was sagen sie?»
«Sie haben keine Ahnung, was los ist. Sie wollen alles genau untersuchen. Ich muss die ganze Woche hierbleiben.»
Ich ahnte, was das für dich bedeutete. Und: Das würde nicht meine letzte Reise gewesen sein.
(«Alles aus Liebe», XXXIX)