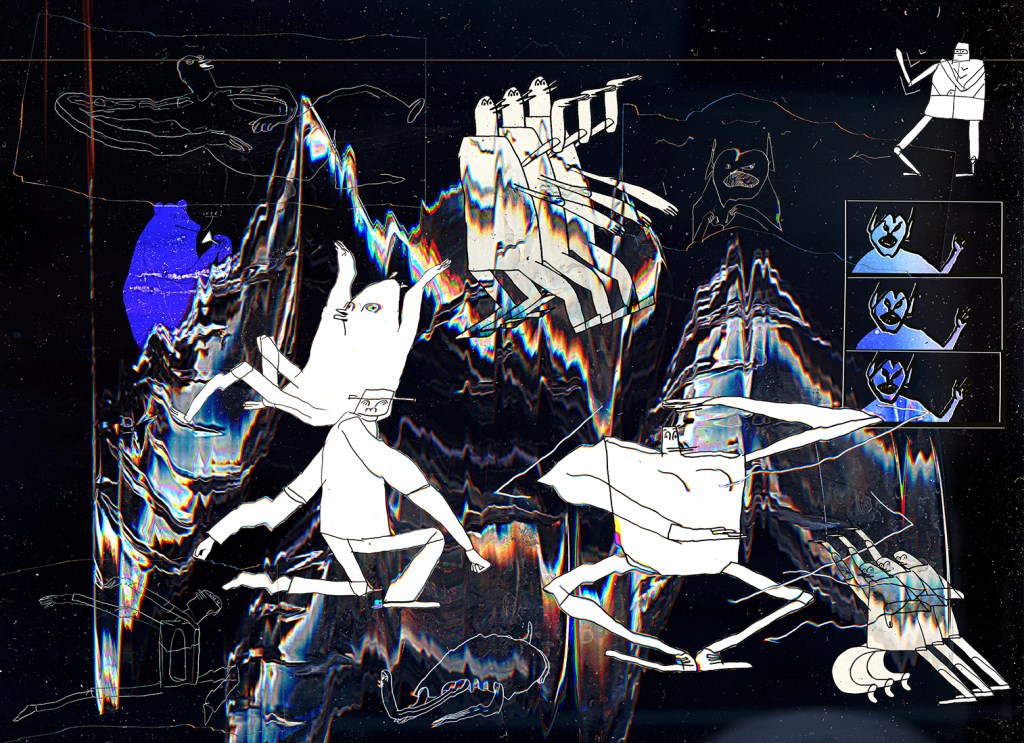Einsam stand er am Strassenrand, er hatte seine besten Zeiten hinter sich. War er früher, es war nicht mal lange her, der Star der Strasse gewesen, so beachtete ihn heute kaum jemand mehr. Die, welche ihn noch vor kurzem fröhlich angelacht hatten, liefen nun achtlos an ihm vorüber. Irgendwie konnte er es auch verstehen. Er sah wirklich heruntergekommen aus. Die Zähne waren ihm ausgefallen, der Schal war dreckig und schmuddelig und seine einst stattliche Figur war geschrumpft. Was mal ein fröhliches Lachen in seinem Gesicht gewesen war, glich nun einer Fratze. Dabei hatte sein Leben so schön angefangen.
Eines Morgens, als es frisch geschneit hatte, kamen die Kinder aus der ganzen Strasse fröhlich lachend angerannt. Alle waren sie dick eingepackt, trugen bunte Mützen mit Bommeln dran und Wollhandschuhe. Ihre Wangen waren vor Freude und Kälte rot, sie plauderten und lachten, warfen sich den frischen Schnee ins Gesicht und waren sichtlich glücklich über das kalte Weiss, das noch immer unablässig vom Himmel fiel und auf dem Boden schon eine stattliche Schicht hinterlassen hatte.
Eifrig machten sie sich ans Werk. Ein Junge formte einen kleinen Schneeball und rollte ihn durch den Schnee. Er wurde gross und grösser, so dass er ihn schon bald nicht mehr alleine bewegen konnte. Schnell kamen die anderen hinzu und halfen ihm, bis eine stattliche Kugel entstanden war. Auf die gleiche Weise machten sie noch eine zweite Kugel, nicht ganz so gross, und hoben sie dann gemeinsam auf die erste Kugel. Die Anstrengung hatte ihre Wangen noch röter werden lassen, kalt war ihnen schon lange nicht mehr. Und: Sie waren noch lange nicht fertig, es brauchte noch eine dritte Kugel. Als sie auch diese gerollt hatten, standen sie da und wussten nicht wie weiter. Wie sollten sie diese nun auf die anderen beiden Kugeln heben? Sie war viel zu schwer und es war auch zu hoch. Zum Glück kam in dem Moment ein Mann vorbei, der die Kinderschar bei ihrem Tun beobachtet hatte. Er lachte fröhlich, denn er konnte sich noch gut erinnern, wie es gewesen war als er mit seinen Freunden an der gleichen Stelle auch einen Schneemann gebaut hatte.
„Braucht ihr Hilfe?“, fragte er. „Au ja, unbedingt!“, kam es ihm im Chor entgegen.
Gemeinsam hoben sie die dritte Kugel auf die ersten beiden. Was für eine Freude – fertig war der Schneemann.
Doch halt – er war noch lange nicht fertig. Jetzt ging es erst richtig los. Der Schneemann brauchte ja noch Augen und einen Mund, eine Nase und Arme, Kleider und vieles mehr, denn sonst wäre es ja nur irgendein Schneemann gewesen, aber es sollte ihr Schneemann sein. Schnell rannten die Kinder nacht Hause, um zu sehen, was sie Brauchbares finden konnten. Als alle wieder beim Schneemann versammelt waren, begutachteten sie die Ausbeute.
Sie hatten eine Möhre, die sie als Nase mitten in den Kopf steckten. Aus zwei Walnüssen machten sie zwei Augen links und rechts, die vielen schwarzen Knöpfe liessen sich gut zu einem Mund formen. Ein altes Nudelsieb war ein prima Hut – sie konnten sogar eine Plastikblume zur Zier in eines der Löcher stecken. Danach wickelten sie ihrem Schneemann einen Schal um den Hals und freuten sich: Das würde der schickste Schneemann überhaupt. Schnell steckten sie ihm noch zwei Äste als Arme in den Körper und da stand er nun. Stattlich und gross und wunderschön. Fröhlich schaute er in die Welt hinaus.
„Wie soll er denn heissen?“, fragte ein Junge. „“Wir brauchen einen Namen, der zu ihm passt.“ „Wie wäre es mit Herr Karl?“, fragte ein kleines Mädchen, denn so hiess die Hauptfigur in ihrem Lieblingsbuch. Alle waren begeistert. Mittlerweile war es Mittag geworden und die Kinder mussten nach Hause. Schnell verabschiedeten sie sich von Herrn Karl und rannten nach allen Seiten davon.
Alle menschen, die an Herrn Karl vorbeiliefen, mussten lachen. Wie gut konnten sie sich an ihre eigenen Schneemänner und die Freude am Bauen erinnern. Man hörte ein fröhliches „Weisst du noch…“ aus vielen Mündern. Zudem war Herr Karl wirklich ein sehr stattlicher und schöner Schneemann. Die Strasse war durch ihn eine fröhlichere geworden.
Nach dem vielen Schneefall kam bald auch wieder die Sonne. Wie schön der Schnee glitzerte und funkelte. Und mittendrin Herr Karl. Nun sah er noch schöner aus. Leider litt Her Karl unter den heissen Sonnenstrahlen. Der Schweiss lief ihm unter seinem Hut hervor, das Gesicht hinunter und durchdränkte seinen Schal. Ab und zu nahm ein Schweisstropfen auch einen Knopf des Mundes weg. Zuerst hatte er eine Zahnlücke, dann fehlte immer mehr. Herr Karl verlor seine Nase, sie hatte keinen Halt mehr im immer weicher werdenden Kopf.
Nach und nach verlor Herr Karl sein stattliches Ansehen, er fiel förmlich in sich zusammen und verkümmerte. Eines Morgens war Herr Karl verschwunden. Am Boden lagen nur noch sein Hut und ein paar Knöpfe. Vermutlich hatte er die Möhre und die Nüsse als Proviant auf seine Reise mit genommen.
Leb wohl, Herr Karl!