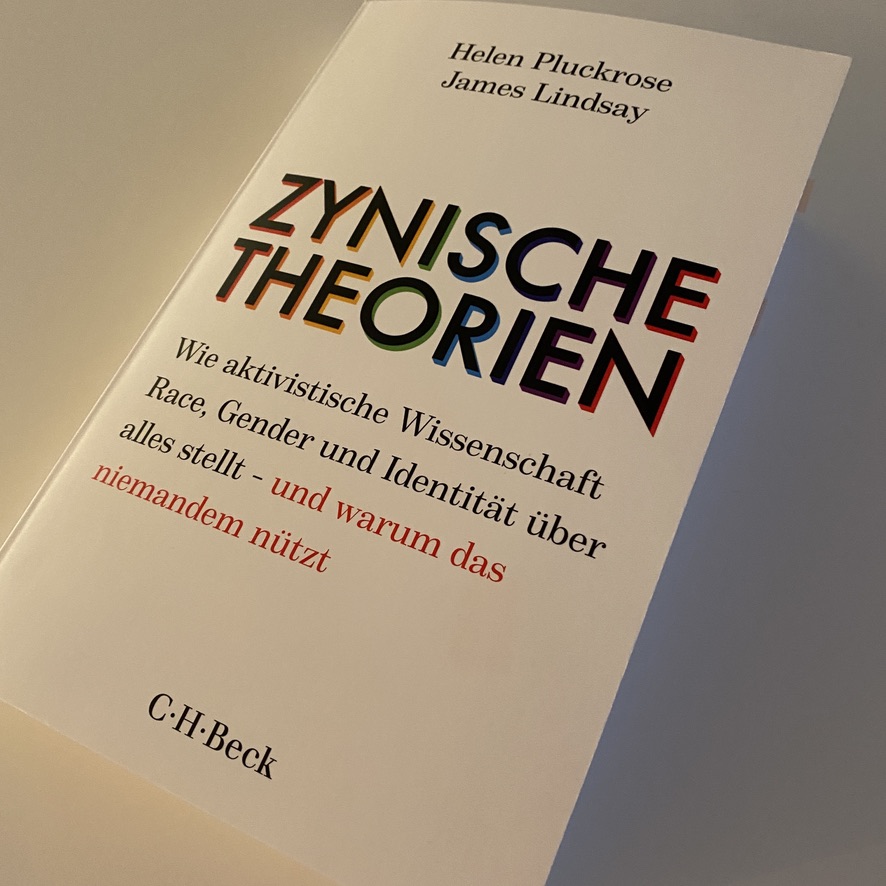Wie aktivistische Wissenschaft Race, Gender und Identität über alles stellt – und warum das niemandem nützt
Inhalt
„Die Kernprobleme der Critical-Race-Theorie sind: dass sie Kategorien rund um das Thema Race wieder soziale Bedeutung zuschreibt und damit Rassismus entfacht, dass sie rein auf der Theorieebene argumentiert, dass sie sich auf das postmoderne Wissensprinzip und das politische Prinzip des Postmodernismus stützt, dass sie zutiefst aggressiv ist, dass sie ihre Relevanz für alle Aspekte sozialer Gerechtigkeit behauptet und dass sie nicht zuletzt von der Annahme ausgeht, Rassismus sei immer und überall gegeben.“
Ein neuer moralischer Kanon erobert die Universitäten und breitet sich in der Gesellschaft aus: Das System ist strukturell schlecht und gefährlich, Menschen sind historisch geprägt und damit in ihren Rollen festgeschrieben – Weisse sind per se Rassisten (und nur sie), Männer toxisch, Heterosexuelle rückständig und andere Formen der Sexualität unterdrückend und Sprache ist sexistisch und abwertend. Mit aggressiven Ansätzen und halbwissenschaftlichen Methoden versuchen Vertreter der sogenannten Social-Justice-Bewegung unter dem Deckmantel des Strebens nach mehr sozialer Gerechtigkeit und weniger Diskriminierung ein Weltbild zu zementieren, das keinen Widerspruch duldet.
Helen Pluckrose und Janes Lindsay nehmen sich in diesem Buch dieser Thematik an, analysieren die vorgebrachten Theorien und setzen sie in Bezug zu einem Liberalismus, welcher sich die gleichen Ziele auf die Fahnen schreibt, dies aber mit einem realistischeren Menschenbild und einer freiheitlicheren Methode, welche mit Dialog statt mit absolutistischen Argumenten agiert.
Herausgekommen ist eine tiefgründige Analyse des postmodernistischen Gedankenguts der Social-Justice-Bewegung, die sich auf die Fahnen schreibt, sich für die soziale Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung (in Bezug auf Race, Gender und Identität) einzusetzen, dabei die Deutungshoheit für sich proklamiert und der Sache an sich einen Bärendienst erweist auf diese Weise.
Weitere Betrachtungen
„Wenn beispielsweise von „Rassismus“ gesprochen wird, bezieht sich das Wort nicht auf rassistische Vorurteile, sondern vielmehr, nach Definition der Social-Justice-Bewegung, auf ein grundlegend rassistisches System, das die gesamte Gesellschaft durchzieht und weitgehend unsichtbar und unbemerkt bleibt; es kann nur von denjenigen erkannt werden, die Rassismus selbst erfahren oder die richtigen „kritischen“ Methoden erlernt haben, mit deren Hilfe sich dieser allgegenwärtige, versteckte Rassismus aufspüren lässt.“
Alle Weissen sind per se Rassisten. Ihre Hautfarbe macht sie dazu. Wenn sie sich einsetzen gegen Rassismus, wenn sie sich stark machen für Opfer von Rassismus, sind sie umso mehr Rassisten, da sie mit dem Einsatz nur (unterbewusst) ihre Schuld zu verdecken suchen. Jeder Weisse muss sich schämen. Das sind die Ansichten in Bezug auf Rassismus, wie sie von der Social-Justice-Bewegung vertreten werden. Analog argumentieren sie bei anderen Themen wie Gender und Sexismus. Sie argumentieren vordergründig sachlich und nachvollziehbar, oft mit akademischem Anspruch (dem Postmodernismus verpflichtet), allerdings immer unter Ausklammerung von Gegenargumenten, die sie nicht nur nicht berücksichtigen, sondern auch nicht hören wollen. Jegliche Art von Widerspruch wird als Rassismus, Sexismus oder Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung ausgelegt.
„Dessen [Liberalismus] wichtigsten Grundsätze bestehen in politischer Demokratie, in der Einhegung und Begrenzung der Regierungsmacht, der Entwicklung universeller Menschenrechte, rechtlicher Gleichheit erwachsener Bürger, Meinungsfreiheit, dem Respekt für die gesellschaftliche Bedeutung von Meinungsvielfalt, offenen Debatten, Evidenz und Vernunft der Trennung von Kirche und Staat und der Religionsfreiheit.“
Soziale Gerechtigkeit ist ein Ziel, das schon der Liberalismus anstrebt und zwar mit Argumenten, die auf einem Menschenbild von Freien und Gleichen basiert, die wissenschaftlich fundiert und zielorientiert sind. es geht beim Liberalismus darum, dass Individuen im Zentrum stehen und gemeinsam für eine Welt kämpfen, in welcher gleiche Rechte und keine Diskriminierung vorherrschen. Der Postmodernismus geht weiter:
„Es geht um die Rekonstruktion der Gesellschaft nach dem Vorbild einer Ideologie, die sich selbst als „Social Justice“ bezeichnet.“
Der Postmodernismus unterstellt, dass die Gesellschaft unterlaufen ist von althergebrachten Strukturen, die nur von den Eingeweihten wahrgenommen und von den anderen geglaubt werden müssen. Die Argumentation des Postmodernismus zeichnet nicht nur das Bild des Menschen als ein für allemal festgeschrieben ohne eigene Möglichkeit des Hinterfragens und sich Positionierens, sie ist auch zutiefst demokratiefeindlich, da sie einen Dialog per se ausschliesst. Sie weist totalitäre Ansprüche auf und ist nur schon deswegen höchst bedenklich.
Persönlicher Bezug
„Wir vertreten die Ansicht, dass die Methoden der Social-Justice-Forschung einen immensen wissenschaftlichen wert haben und die Sache der Menschheit beträchtlich voranbringen können (nicht zuletzt was die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit betrifft), wenn sie reformiert und wissenschaftlich hieb- und stichfest gemacht werden.“
Soziale Gerechtigkeit ist ein grosses Thema und eines, dass die Menschen theoretisch und als Betroffene seit Menschengedenken beschäftigt. Immer wieder gab es Bewegungen, die sich mit viel Kraft für mehr Rechte einsetzte, immer wieder kam es auch zu Fortschritten, welche aus der Gesellschaft eine immer gerechtere machten: Rassismus ist im Gesetz verankert, Chancengleichheit für Männer und Frauen ebenfalls, Gewalt aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion und mehr wird geahndet, sexistisches Verhalten ebenfalls. Dass nach so vielen Jahrzehnten der Prägung in vielen Köpfen noch alte Rollenmodelle und damit auch Verhaltensmuster präsent sind, verwundert nicht. Statt aber diese grundsätzlich fest- und zuzuschreiben, damit Gräben zu errichten und eigentlich mit derselben Argumentation zu agieren, die man eigentlich bekämpfte, wäre es sinnvoller, die tatsächlichen Missstände zu benennen, sie dadurch ins Bewusstsein zu rufen und Methoden zu entwickeln, wie man ihnen beikommen könnte.
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch sich ändern kann, dass er zwar in eine Welt geworfen wird, die er sich nicht ausgesucht hat, dass er durchaus auch geprägt wird von dieser Welt, dass er aber die Fähigkeit hat, sich und die Welt zu hinterfragen und sich in dieser Welt nach seinen Werten zu positionieren. Ich halte es mit dieser Sicht mit Sartre, welcher befand, dass man sich selber erschaffen kann, dass dies die anzustrebende Freiheit ist, die aber eine Verantwortung mit sich bringt, nämlich die Verantwortung für das eigene Sein. Damit wäre keiner durch irgendein äusseres Merkmal ein für alle Mal festgeschrieben, sondern es bestünde die Möglichkeit einer Veränderung, was sich im Miteinander zeigen könnte und zu einer gerechteren Welt führen könnte.
Fazit
Ein tiefgründiges, differenziertes und doch gut lesbares Buch über über das postmodernistische Gedankengut der Social-Justice-Bewegung, die der sozialen Gerechtigkeit einen Bärendienst erweist mit ihren aggressiven und absolutistischen Argumenten. Sehr empfehlenswert.
Die AutorInnen
Helen Pluckrose ist liberale Publizistin, Gründerin der Plattform „Counterweight“ und ehemalige Chefredakteurin des „Areo Magazine“. Sie hat zahlreiche Essays über die Postmoderne, die kritische Theorie, den Liberalismus, Säkularismus und Feminismus verfasst. Pluckrose lebt in London, England.
James Lindsay ist Mathematiker und Buchautor. Seine Essays sind in zahlreichen Zeitungen und Magazinen erschienen, darunter das „Wall Street Journal“, die „Los Angeles Times“ und „Time“. Lindsay lebt in Tennessee, USA.
Angaben zum Buch
Herausgeber: C.H.Beck; 1. Edition (17. Februar 2022)
Taschenbuch: 380 Seiten
ISBN-Nr.: 978-3406781384