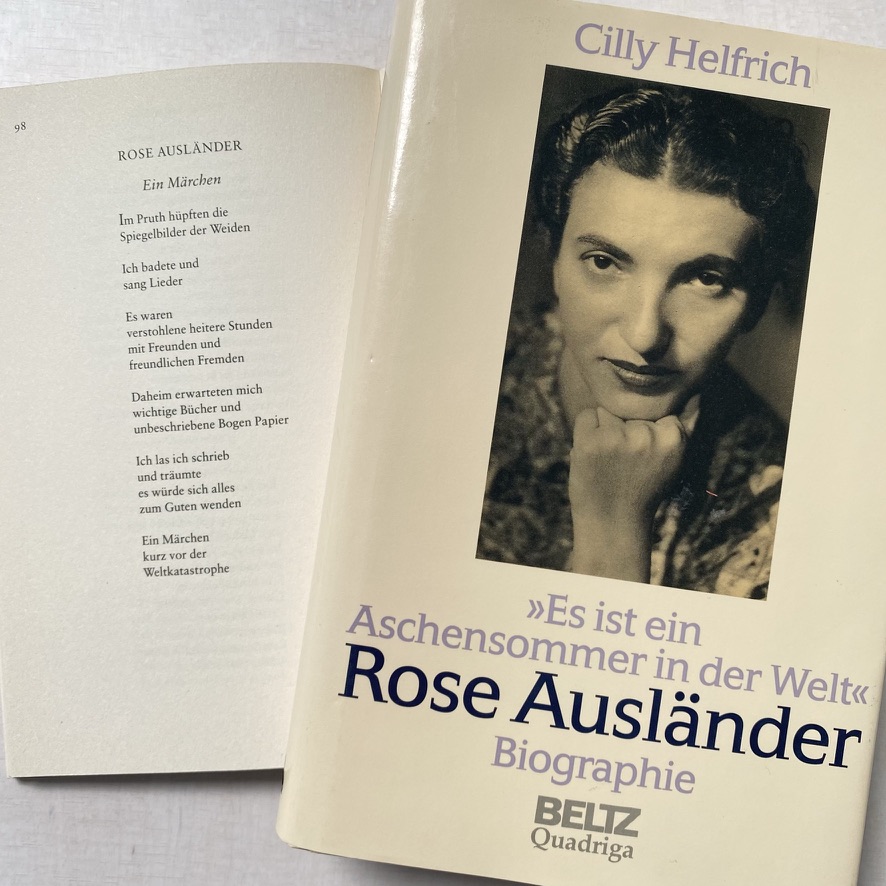Katja Kulin
Katja Kulin wurde in Bochum-Wattenscheid geboren und lebt seit Mitte 2018 in einem kleinen Dorf in der Voreifel. Das Schreiben war schon als Kind präsent in ihrem Leben, als sie die alte Schreibmaschine ihrer Mutter in beschlag nahm und in die Tasten hämmerte. Nach der Schule studierte sie Germanistik und Erziehungswissenschaften, begann später erst ernsthaft in eigner Sache, fern der Universität zu schreiben. 2015 erschien ihr erster biografischer Roman bei Herder, 2016 dann ihr Romandebüt bei Ullstein. Neben dem Schreiben von Romanen, Romanbiografien und Sachbüchern ist sie als Lektorin/Korrektorin tätig.
Ihr aktuelles Buch: Der andere Mann. Die große Liebe der Simone de Bauvoir.
Wer bist du? Wie würdest du deine Biografie erzählen?
Als sogenanntes „Arbeiterkind“ bin ich eher bildungsfern aufgewachsen, aber mir wurde als kleines Kind aus Bilderbüchern vorgelesen (leider nicht selbstverständlich, wie ich später von anderen erfahren habe), und mein Vater hat Geschichten über eine kleine Katze für mich erfunden. Ich konnte nie genug davon bekommen es kaum erwarten, selbst das Lesen zu lernen. Von da an war ich ständiger Gast in der Bücherei und habe mir auch schon früh selbst Geschichten ausgedacht.
Dass Schriftstellerin ein richtiger Beruf sein könnte, kam in meiner Welt aber lange nicht vor. Viele Jahre habe ich als Lerntrainerin Kindern und Jugendlichen bei Schulproblemen geholfen und das auch sehr gern gemacht. Das Schreiben habe ich aber irgendwann als Hobby wieder aufgenommen. Inzwischen hat sich schönerweise der Kreis geschlossen und ich darf meinen Unterhalt mit dem Schreiben verdienen. Außerdem unterstütze ich andere Autor:innen als Lektorin oder Korrektorin bei ihren Buchprojekten.
Wieso schreibst du? Wolltest du schon immer Schriftstellerin werden oder gab es einen Auslöser?
Das Schreiben ist einerseits eines der Dinge ist, die ich am besten kann und die mich erfüllen, gleichzeitig ist es aber auch die eine Sache, in der ich mich noch am meisten weiterentwickeln, über die ich noch am meisten lernen will.
In der Grundschule hatte ich in der vierten Klasse einen Deutschlehrer, der meine Aufsätze sehr besonders fand und mich ermutigt hat. Das hat mir damals viel bedeutet.
Es gibt diverse Angebote, kreatives Schreiben zu lernen, sei es an Unis oder bei Schriftstellern. Ist alles Handwerk, kann man alles daran lernen oder sitzt es in einem?
Was mich selbst angeht, glaube ich, ein gewisses Talent in die Wiege – oder besser in die Gene – gelegt bekommen zu haben, auf dem sich dann ganz selbstverständlich aufbauen ließ.
Das Handwerk ist eine wichtige Komponente, die sich erlernen lässt, aber sie ist längst nicht alles. Grundsätzlich führen viele Wege zum Ziel, denke ich. Ich bin seit vielen Jahren Moderatorin im Deutschen Schriftstellerforum und habe dort den Weg so einiger Autor:innen bis zur Veröffentlichung begleitet. Einige davon haben sich lange und intensiv mit Schreibratgebern auseinandergesetzt und mehrere Romane zur Übung verfasst, bevor sie an eine Veröffentlichung dachten, andere haben mit ihrem Erstling und aus dem Bauch heraus gleich einen Treffer gelandet.
Woher holst du die Ideen für dein Schreiben? Natürlich erlebt und sieht man viel, aber wie wird eine Geschichte draus?
Was meine Romanbiografien angeht, steht an erster Stelle die Überlegung, welche historische Person ich denn grundsätzlich spannend finde. Dann gehe ich auf die Suche nach einer besonders interessanten oder konfliktreichen Phase in deren Leben, die ich porträtieren möchte. Bei der Recherche formt sich dann meist schon eine Szene in meinem Kopf, mit der dann beginne.
Meine Romanideen beinhalten in der Regel Themen, die mich persönlich beschäftigen oder in meinem Umfeld eine Rolle spielen; Dinge, mit denen ich mit gedanklich auseinandersetze oder die ich individuell, aber auch gesellschaftlich für relevant halte.
Wenn du auf deinen eigenen Schreibprozess schaust, wie gehst du vor? Entsteht zuerst ein durchdachtes Gerüst oder aber schreibst du drauflos und schaust, wo dich das Schreiben hinführt?
Wenn ich zu dem Schluss komme, eine Idee wirklich umsetzen zu wollen, überlege ich mir mittlerweile zuerst den groben Aufbau und bei fiktionalen Romanen auch die Figuren, die auftreten sollen. Für meine Agentur und interessierte Verlage verfasse ich dann ein erstes Exposé und eine Leseprobe. Viele Details kommen erst beim Schreiben hinzu, und natürlich ändert sich manchmal auch noch etwas an der Grobstruktur, wenn ich merke, dass es irgendwie nicht funktioniert. Im Schreibprozess selbst bin ich mir dann immer ein paar Szenen voraus, das heißt, ich plane drei bis vier Szenen genauer vor, damit ich beim Schreiben vor Augen habe, wo ich hinwill.
Wie schreibst du? Noch mit Papier und Stift oder alles am Computer? Und: Hat das Schreibmittel deiner Meinung nach einen Einfluss auf den Schreibprozess?
Erste Notizen mache ich mir sehr gern handschriftlich, den eigentlichen Text schreibe ich am Computer. Zum Überarbeiten drucke ich alles aus und kritzele mit dem Stift an den Rand, was mir auffällt, und arbeite es dann später am Computer ein. Das Schreiben mit der Hand ist meiner Erfahrung nach mit mehr Nachdenken verbunden bzw. fließen die Gedanken dabei besser, weshalb es sich besonders gut für erste Überlegungen eignet.
Gab es Zeiten in deinem Leben, wo der Schreibfluss versiegte? Und wenn ja, wie gingst du damit um?
Ich bin generell niemand, der jeden Tag ein oder zwei Seiten schreibt, obwohl ich mir das gern antrainieren würde. Vielmehr gibt es wochenlange intensive Phasen, in denen ich sehr viel schreibe, und dann auch mal einen oder zwei Monate, in denen ich nur recherchiere, neue Ideen zerdenke oder einfach etwas anderes mache.
Schreibblockaden kenne ich eher nicht bzw. steckt an solchen Tagen meist nur die Angst vorm Versagen oder auch schnöde Prokrastination dahinter.
Ich hörte mal, der grösste Feind des Schriftstellers sei nicht mangelndes Talent, sondern die Störung durch andere Menschen. Brauchst du zum Arbeiten Stille und Einsamkeit, oder stören Sie andere Menschen nicht?
Tatsächlich bin ich beim Schreiben am liebsten allein (vom Hund mal abgesehen), ich kenne aber auch Autor:innen, die immer und überall schreiben können.
Hat ein Schriftsteller je Ferien oder Feierabend oder bist du ständig „auf Sendung“? Wie schaltest du ab?
Abschalten kann ich eigentlich problemlos, aber gerade in intensiven Schreibphasen spukt ein Projekt einem natürlich ständig im Kopf herum, und auch das Unbewusste arbeitet unbemerkt weiter und lässt ab und an wie aus dem Nichts Durchbrüche für Plotprobleme oder Ähnliches ins Bewusstsein dringen. Das sind dann schöne Aha-Erlebnisse.
Was sind für dich die Freuden beim Leben als Schriftstellerin, was bereitet dir Mühe?
Neben den erwähnten Durchbrüchen finde ich generell die unbewussten Prozesse beim Schreiben sehr spannend. Eigentlich immer bemerke ich beim Durchlesen einer ersten Fassung, dass ich einen roten Faden, ein durchgehendes Motiv, gesponnen habe, ohne es bewusst geplant zu haben.
Mühe bereitet es mir ehrlich gesagt immer wieder aufs Neue, mich überhaupt hinzusetzen und mit dem Schreiben anzufangen. Aber wenn dieser Punkt überwunden ist, läuft es dann in der Regel gut.
Goethe sagte einst, alles Schreiben sei autobiographisch. Wie viel von Katja Kulin steckt in deinen Büchern?
Meiner Meinung nach ist es unmöglich, eine „Einmischung“ der eigenen Person zu verhindern. Alles, was wir erleben, interpretieren wir ja vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen, unserer Gene, unserer Biografie, und natürlich beeinflusst das immer auch unsere Texte.
In meinen Romanen steckt dabei sicher noch mehr Persönliches als in den Romanbiografien, wobei ich da nicht nur aus meiner eigenen Person, sondern auch aus meinem gesamten Umfeld schöpfe. Und natürlich findet das, was mich persönlich bewegt, auch den Weg in meine Bücher.
Du hast schon einige Romanbiografien geschrieben. Was gefällt dir an dem Genre?
Tief in das Leben spannender Persönlichkeiten abzutauchen, finde ich einfach unglaublich interessant und inspirierend. Ermutigend ist, dass sich dabei immer zeigt, dass diese tollen Menschen auch große Schwächen hatten, Zweifel; dass sie nicht nur „gut“ waren, sondern, wie wir alle, viele Facetten hatten. Das auch herauszuarbeiten, ist mir sehr wichtig. Grundsätzlich lässt sich aus gelebtem Leben immer auch viel für das eigene mitnehmen, finde ich.
Dein neustes Buch handelt von Simone de Beauvoir und ihrer Liebe zu Nelson Algren. Wie kamst du auf sie, was hat dich an just dieser Episode aus ihrem Leben gereizt?
Beauvoir und Algren waren beide außergewöhnliche und gleichzeitig sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die als Schreibende auf ganz verschiedene Weise Stellung zu der Gesellschaft nahmen, in der sie lebten. Beide haben in der Zeit ihrer Beziehung ihre erfolgreichsten Werke verfasst und ein bedeutendes Vermächtnis hinterlassen.
Die Entstehungsgeschichte dieser Werke fand ich schon spannend genug, aber vor allem haben mich die Diskrepanzen und Zwiespalte interessiert, die sich bei der näheren Recherche offenbarten, zum Beispiel beim Lesen der Briefe. Die Beziehung Beauvoirs zu Algren war nämlich eine mit zeitweise beinahe klassischer Rollenverteilung, ganz untypisch für sie. Und das ausgerechnet, während sie das Buch schrieb, das dem Feminismus neuen Aufschwung gab.
Wenn du an ein nächstes Projekt denkst, könnte das auch ein anderes Genre sein oder bleibst du deinem treu?
Ich habe schon ein Konzept für eine neue Romanbiografie entwickelt, aber ich arbeite gerade auch einige Ideen für Romane aus, die ich gern schreiben würde.
Wenn du auf deine Bücher zurückschaust, gibt es ein Lieblingsbuch, eines, das dir am nächsten ging, am wichtigsten war und noch ist?
Mein Roman „Normal ist anders“ ist mir sehr wichtig, vor allem wegen der Botschaft, um die es mir beim Schreiben ging. Das Buch begleitet Lea, die nichts mehr essen kann, weil sie Angst vor dem Ersticken hat. Die Leser:innen erleben ihren Weg zur Gesundung in der Psychiatrie mit, wo sie weitere Menschen kennenlernt, die „anders“ sind: Ben, der zwanghaft Kram und Zitate sammelt, den soziophoben Transsexuellen Ismail, der in der Klinik seine ersten Schritte als Frau macht, die langsam gebrechlich werdende, aber liebenswert resolute bipolare Künstlerin Anna und einige mehr.
Es ist nicht nur die Therapie bei einem sehr unkonventionellen Therapeuten, die Lea hilft, sondern vor allem auch die gegenseitige Akzeptanz und Unterstützung der Freunde. Die Figuren sind beim Schreiben damals so lebendig geworden, dass ich mich noch heute praktisch so an sie erinnern kann, als wären sie echte Menschen.
Die meisten Schriftsteller lesen auch viel – gibt es Bücher, die dich geprägt haben, die dir wichtig sind, Bücher, die du empfehlen würdest?
Sehr nachhaltig beeindruckt hat mich Sibylle Bergs „GRM“. Berg schreibt wie keine andere, ich lese sie schon lange, aber „GRM“ ist für mich ihr Meisterstück.
Mein eigenes Schreiben sehr inspiriert und, glaube ich, auch verändert hat „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ von Peter Høeg, ein Buch, das ich als junge Frau gelesen habe. Fasziniert hat mich daran gar nicht so sehr die Geschichte, sondern vielmehr die Umsetzung. Høeg hat eine einzigartige Protagonistin erschaffen und auf eine wunderbar indirekte, rätselhafte und auch poetische Weise erzählt.
Welche fünf Tipps würdest du einem angehenden Schriftsteller geben?
- Viel lesen, vor allem auch in dem Genre, das man schreiben möchte.
- Die ersten Schreibschritte ruhig unbeeinflusst machen, dann aber auch die Veröffentlichungsreife intensiv prüfen, indem man das eigene Manuskript mit anderen Werken des Genres vergleicht, Schreibratgeber kritisch liest, Meinungen von Testleser:innen einholt und immer wieder überarbeitet.
- Sich mit der Branche auseinandersetzen und Pseudoverlage meiden, die Geld von Autor:innen nehmen und darum alles drucken würden.
- Eine Agentur suchen, wenn eine Veröffentlichung in einem Großverlag das angestrebte Ziel ist.
- Gleichgesinnte zum Austausch finden und dabei vor allem von denen lernen, die in ihrer Entwicklung schon mindestens einen Schritt weiter sind als man selbst.
Die Rezension zu Katja Kulins Buch „Der andere Mann – Die grosse Liebe der Simone de Beauvoir“ findet ihr HIER