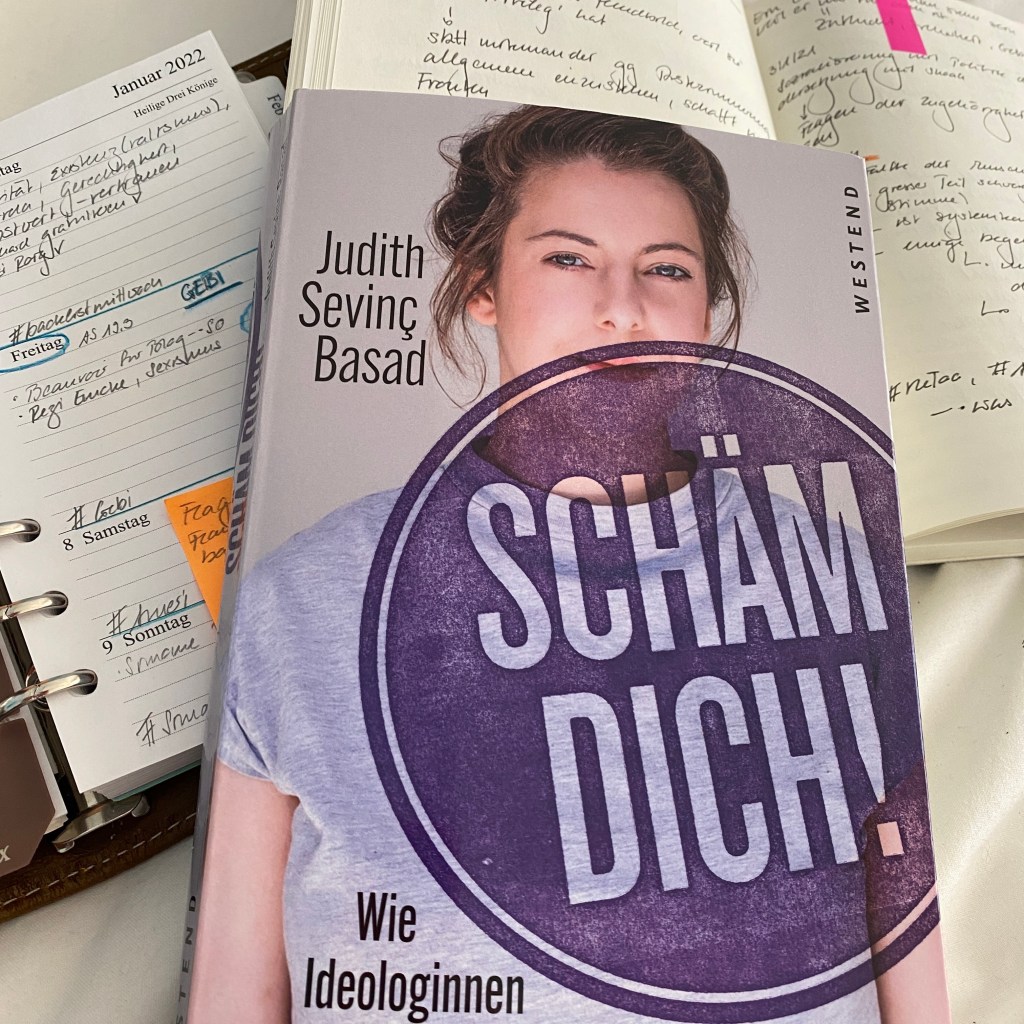Kürzlich sagte Whoopi Goldberg in einer TV-Show, beim Holocaust sei es nicht um Rasse gegangen, sondern um die Unmenschlichkeit von Menschen gegen Menschen.
«The Holocaust isn’t about race. It’s about men’s inhumanity to men. These are two white groups of people. The minute you turn it into ‹race›, it goes down this alley. Let’s talk about what it is, it is about how people treat each other. It is a problem.»*
Diese Aussage ist in zweierlei Hinsicht problematisch: Man könnte sie als Verharmlosung des Holocaust auffassen, was auch so passiert ist. Dass sich Goldberg von dieser Sicht distanzierte, spielte dabei keine Rolle mehr. Und ja: Eine Verharmlosung oder eine Negierung des Holocausts ist ein moralisches Verbrechen und sollte – dies meine Meinung, die ich auch in meiner Dissertation vertreten habe – auch rechtlich bestraft werden. Völkermordleugnung (Verharmlosung qualifiziert als solche) stellt ein zweites Verbrechen gegen die Opfer dar, weil diese in einem Punkt, der ihre Persönlichkeit so nachhaltig prägte, verleugnet und damit (ein zweites Mal) ausgelöscht werden. Aber: Das steckt in Goldbergs Aussage nicht drin. Goldberg zweifelt nicht die Schwere und Grausamkeit des Holocausts an, sie kritisiert den Umstand, dass man als Beweggrund Rassismus sehe, da die Opfer ja weiss waren.
In Amerika ist es in der Tat so, dass Rassismus hauptsächlich an der Hautfarbe festgemacht wird und das grundsätzlich so, dass weisse Menschen immer die Rassisten, schwarze die Opfer sind. Rassismus gegen Weisse gibt es nicht, weil Rassismus strukturell sei und die Unterdrückung der Schwarzen Geschichte hätte. Dies die Begründung einer Meinung, die mittlerweile auch in Europa vermehrt vertreten wird. Wenn man diese Hypothese (und mehr ist es nicht) bestätigt, liegt Whoopi Goldberg mit ihrer Aussage richtig.
Wenn man einen Blick in die Geschichte wagt, wird es komplizierter. Ursprünglich stammt der Begriff der Rasse aus der Biologie und bezeichnet da (sehr umstritten) eine Gruppe, welche aufgrund willkürlich gewählter Kriterien Ähnlichkeiten aufweisen. Später hat man den Begriff angepasst und nur noch auf Unterarten von Arten angewendet, bis man ihn in der Biologie aus der Tierwelt gestrichen hat. Dass man nun bei Menschen immer noch von Rassen sprechen will, ist fragwürdig. Gerade wenn es darum geht, Rassismus zu eliminieren, wäre es sinnvoll, Rassengrenzen aufzulösen. Indem nun aber Schwarze sich dermassen von Weissen abgrenzen, zementieren sie den Rassenbegriff selber und schreiben sich in der jüngeren Diskussion den Opferstatus mit auf den Leib.
Es ist unbestritten, dass Menschen ohne weisse Hautfarbe, je dunklhäutiger desto mehr, über Jahrhunderte Opfer von Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt worden sind, man denke an die Sklaverei, an das Apartheid-System, Kolonialisierungen. Auch innerhalb von Ländern wurde Hautfarbe oft als Kriterium für den Status in der Gesellschaft gesehen, man denke nur an das Kastensystem in Indien (allerdings ist auch das durch Weisse ausgelöst worden bei der arischen Eroberung Indiens und dessen Kolonialisierung).
Aus dem hier gesagten stellen sich folgende Fragen:
- Ist es sinnvoll, überhaupt noch mit dem Begriff Rasse zu argumentieren und kann man ihn auf ein Merkmal, nämlich die Hautfarbe, reduzieren?
- Ist der Rückgriff auf ein biologisches Merkmal wirklich sinnvoll, wenn man die Diskussion mit der um Sexismus vergleicht, bei der nicht mal mehr das Geschlecht biologisch erklärt werden soll (unabhängig aller optischen Merkmale)?
Zu Punkt 1: Rassismus ist eine eher pseudowissenschaftliche Analogie auf die Biologie, welche den Status eines Menschen aus dessen Erbgut ableiten will, um daraus eine quasi gottgegebene Ordnung und die eigene Überlegenheit zu propagieren. Kriterien sind dabei neben der Hautfarbe auch die Religion, die Sprache und die Kultur. Wenn wir noch einmal einen Blick in die Geschichte wagen, gab es verschiedene Stufen des Rassismus. Zählten im Mittelalter mehrheitlich mythisch und religiös geprägte Kriterien dazu, Rassismus zu begründen, rückten zur Zeit der Aufklärung biologische wie die Hautfarbe ins Zentrum. Ein Zitat des grossen Toleranz-Philosophen Voltaire:
„Die Rasse der Neger** ist eine von der unsrigen völlig verschiedene Menschenart, wie die der Spaniels sich von der der Windhunde unterscheidet […] Man kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige, sie ist ihr weit unterlegen.“***
Im 18. Jahrhundert bildete sich in der Tat ein biologisch geprägter Rassismus heraus, in welchem optische Kriterien mit geistigen und anderen individuellen Fähigkeiten verknüpft wurden. Seit da ist zum Glück viel passiert. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es keine wissenschaftliche Basis für rassische Unterscheidungen gibt, die Unesco deklarierte die Einteilung in Rassen als beliebig und den Rassenbegriff als nichtig und damit abzulehnen. Viele Kämpfe gegen Rassismus, viele Bewegungen für gleiche Rechte, viele weitere Massnahmen zur Bewusstseinsbildung haben seit da dazu geführt, dass Rassismus a) thematisiert, b) mehrheitlich abgelehnt und c) wo nicht erfolgreich, gesetzlich verfolgt wird. Es ist immer noch viel zu tun, aber es ist auch schon viel getan.
Wer kann nun aber Rassismus erfahren? In Bezug auf die Situation in gewissen Quartieren in Amerika kam der Begriff des umgekehrten Rassismus auf. Weisse konnten sich kaum in von schwarzen dominierte Quartiere wagen, da sie mit Gewalt rechnen mussten. Betrachtet man die heutige Diskussion, wird der Begriff des umgekehrten Rassismus von Schwarzen abgelehnt mit der Begründung, Rassismus sei immer strukturell und aus der Geschichte heraus nur auf Schwarze anzuwenden. Ein weisser Mensch ist daher per se durch seine Hautfarbe Rassist. Mehr noch: Äussert er sich gegen Rassismus, ist das einem Übergriff gleichzusetzen, ist er betrübt über einen rassistischen Vorfall, sind das „White tears“ oder „white fragility“, sprich, der Weisse will sich nur profilieren und dem Schwarzen seinen Opferstatus dadurch absprechen, indem er sich von diesem trösten lässt als Quasi-Opfer.
Das ist der Punkt, an dem ich denke, wir leben in einem Irrenhaus. Da kämpfen wir so lange gegen Rassenbegriffe, Klassenbegriffe, sexistische Begriffe und Übergriffe, Geschlechterrollen und mehr – und dann gehen einige dahin und errichten all die Begriffe wieder und schiessen wild um sich. Sie zementieren ihre eigene Opferrolle, stigmatisieren Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe und Gefühle, verbieten die freie Meinungsäusserung aus der Überzeugung heraus, nur ihre eigene Erfahrung tauge als Basis einer Meinung. Das macht mich wütend. Nicht weil es mich trifft, nein, weil es der Sache nicht dient, sondern schaden. Wir streiten nun über solchen Mist, statt gemeinsam die noch vorherrschenden Missstände anzugehen. Wo ist das, was bell hooks Sisterhood nannte? Oder Audre Lorde? Schreibt man sich die nur gerne als Flaggenfiguren auf die eigene Flagge und kocht dann doch ein anderes Süppchen?
Ich möchte hier anfügen: Nein, ich weiss nicht, wie es sich anfühlt, Opfer rassistischer Handlungen aufgrund schwarzer Hautfarbe zu sein. Andere Diskriminierungen kenne ich, diese nicht. Ich weiss nicht, wie sich ein anderer Mensch fühlt (im Sinne von Thomas Nagels „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“), aber ich habe vielleicht genug Empathie, eine Ahnung zu haben davon. Oder anders: Wer kann überhaupt wissen, wie sich ein anderer fühlt?
Nehmen wir an, eine Frau (Anna) verliert ihr Kind. Kann eine Nicht-Mutter erahnen, was in Anna vorgeht? Wohl kaum vollumfänglich, aber doch ansatzweise dadurch, dass sie weiss, wie sich grosses Leid anfühlt. Kann es eine weisse Mutter besser, wenn Anna weiss war? Kann es eine schwarze gleich gut wie eine weisse? Kann es ein weisser Mann besser als eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann? Ich weiss es nicht, ich war weder je schwarz noch war ich je das, was man landläufig einen Mann nennt. Sie alle können es aber genauso wenig wie ich. Qua unseres Menschseins fühlen wir uns ein – darauf hoffe ich im Allgemeinen, Entartungen (und ich zähle fehlende Empathie dazu) gibt es immer, doch sollte man daran nicht die die gesamte Menschheit aufhängen.
Damit sind wir bei Punkt 2: Wenn wir schon das Geschlecht nicht mehr biologisch definieren, wo doch dabei durchaus mehr biologische Kriterien vorhanden sind als bei der ominösen Rasse, wäre es an der Zeit, den Rasse-Begriff endgültig in die Tonne zu treten. Das heisst nicht, dass es keinen Rassismus mehr gibt, das heisst nicht, dass es nicht noch viel zu tun gibt und wir mit offenen Augen und Herzen und wachem Bewusstsein in der Welt sein sollen. Aber es wäre Zeit, dies endlich gemeinsam zu tun und nicht ständig neue Fronten zu bilden durch Opfer- und Täterzuschreibungen.
Um zurück zum Ausgangspunkt zu kommen: Goldbergs Aussage war unangebracht, unnötig und missverständlich (insofern, als man es schon so verstehen könnte, dass es schlimmer gewesen wäre, wenn es tatsächlich um Rasse gegangen wäre – was sie aber nicht gesagt hat und auch bestreitet, gemeint zu haben), aber sie war Teil eines aktuellen Diskurses, in welchem Rasse auf ein Kriterium, nämlich das der Hautfarbe festgelegt ist. Den Holocaust hat sie damit nicht verharmlost, aber ein Thema ans Licht gebracht, das auf den Tisch muss: Rasse ist etwas, das es nicht mehr geben sollte als Argument. Für keinen. Wir müssen lernen als Gesellschaft, Rassismus auszumerzen, wir sollten lernen als Einzelne die je eigene Verantwortung zu übernehmen für unser Verhalten und unseren Beitrag zu Verhalten, welches rassistisch motiviert ist.
_____
*https://www.watson.ch/!400387301?utm_medium=social-user&utm_source=social_app&utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=20220202
**Ich bleibe hier bewusst beim Original-Wort, weil ich die Streichung desselben als kontraproduktiv, den Diskurs um die Gründe der Verwendung als wertvoll erachte für ein wachsendes Bewusstsein.
***Léon Poliakov /Christian Delacampagne /Patrick Girard, Rassismus. Über Fremdenfeindlichkeit und Rassenwahn, Luchterhand-Literaturverlag, Hamburg 1992, ISBN 3-630-71061-1, S. 77.