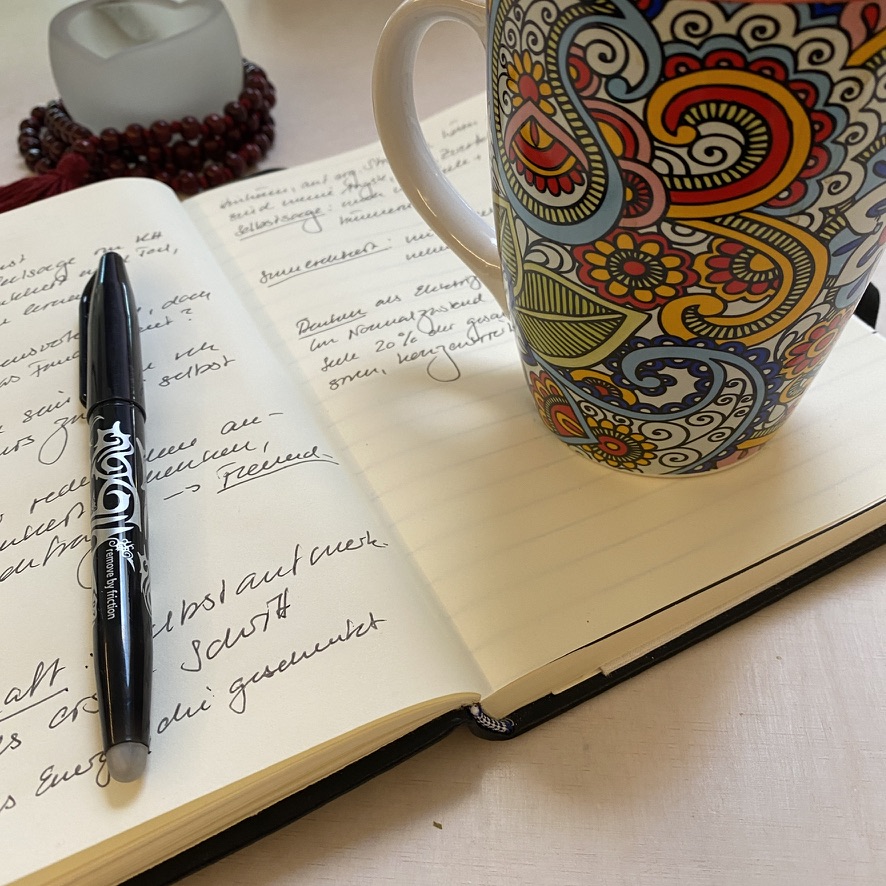«Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu schaffen.»
Das sagte Hermann Hesse und weist damit darauf hin, wie sehr wir uns mit unserem Grenzdenken selbst beschränken. Wie oft schauen wir auf die Welt und denken: „Es ist unmöglich, da etwas zu verändern.“ Oder wir sehen Missstände in der Gesellschaft und geben schon auf, bevor wir Lösungen gesucht haben, weil wir denken, dass die Strukturen nicht zu verändern sind. Wir vergessen dabei, dass diese Strukturen nicht durch eine Naturgewalt entstanden sind, sondern von Menschen gemacht wurden. Und was der Mensch macht, kann der Mensch auch verändern. Dies war auch die Ausgangslage von Jagoda Marinić. Sie wollte nicht nur in der Theorie verharren, sondern etwas auf die Beine stellen. Praktisch. Für Menschen. Ein interkulturellen Zentrums in Heidelberg.
Ein grosser Motivator war die Hoffnung: Denken, dass es möglich ist. Es gab viele Steine auf dem Weg, sie stiess auf kritische Stimmen, Ablehnung und Beleidigungen. Statt mit Wut und Hass zu reagieren entschied sie sich für eine Haltung, die zwar durchaus radikal die Ziele verfolgt, dies aber auf eine gemässigte, leise Weise. Sie suchte den Dialog, hielt durch, war beharrlich. Und es gelang. Von all dem handelt ihr neues Buch «Sanfte Radikalität».
«Sanfte Radikalität, das ist für mich die Entscheidung, eine Idee oder ein Projekt wirklich in die Welt zu bringen, statt Radikalität nur dafür zu nutzen, jene anzuprangern, die anders denken.»
Jagoda Marinić ist der Überzeugung, dass
«Zustände, die sich verändern sollen, nicht besser werden können, wenn die Menschen, die sie verbessern wollen, auf dem Weg dorthin ihre Werte und ja, ihre Sanftmut verlieren.»
In vielen jüngeren Schriften wird Wut gelobt als Motivator, etwas zu bewegen, gegen Missstände aufzubegehren. Dabei passiert es oft, dass sich Fronten mehr und mehr verhärten, weil die, welche mit Wut angegangen werden, nicht einfach anhören, was die Wütenden zu sagen haben, sondern ihre Schutzschilder, die meist aus Gegenschlägen bestehen, hochzuhalten. Auf beiden Seiten wüten dann die Emotionen, die Wut ist das Öl ins Feuer des destruktiven Konflikts, sie verunmöglicht einen sachlichen und konstruktiven Dialog und damit auch die Möglichkeit eines Wandels. Aus dieser Einsicht heraus ging Jagoda Marinić einen anderen Weg:
«Ich brauchte meine Klarsicht, um meine Fähigkeiten zusammenzuhalten, um das, was ich als Möglichkeitsraum sah, zu betreten und meine Kritik an Missständen in etwas Konstruktiveres zu verwandeln.»
Die Welt mag heute wie ein oftmals düsterer Ort erscheinen, in dem viel Unrecht und Leid herrschen. Statt mit Blick darauf zu verzweifeln und Schuldige zu suchen, dürfen wir die Hoffnung nicht verlieren, dass wir die Dinge nicht so lassen müssen, dass wir sie verändern können. Das schaffen wir nur in einem Miteinander. Es gilt also, sich zu verbinden statt immer neue Fronten zu schaffen oder bestehende zu verhärten.
«Wer Wandel will, muss jene finden und gewinnen, die für eine Sache zu begeistern sind, statt auf Radikales mit derselben Art von Radikalität zu antworten.»
Dabei ist jeder aufgefordert.
«Der Einzelne kann immer auch Verantwortung übernehmen, statt anderen nur vorzuwerfen, dass sie die Dinge nicht so tun, wie man es selbst richtig fände.»