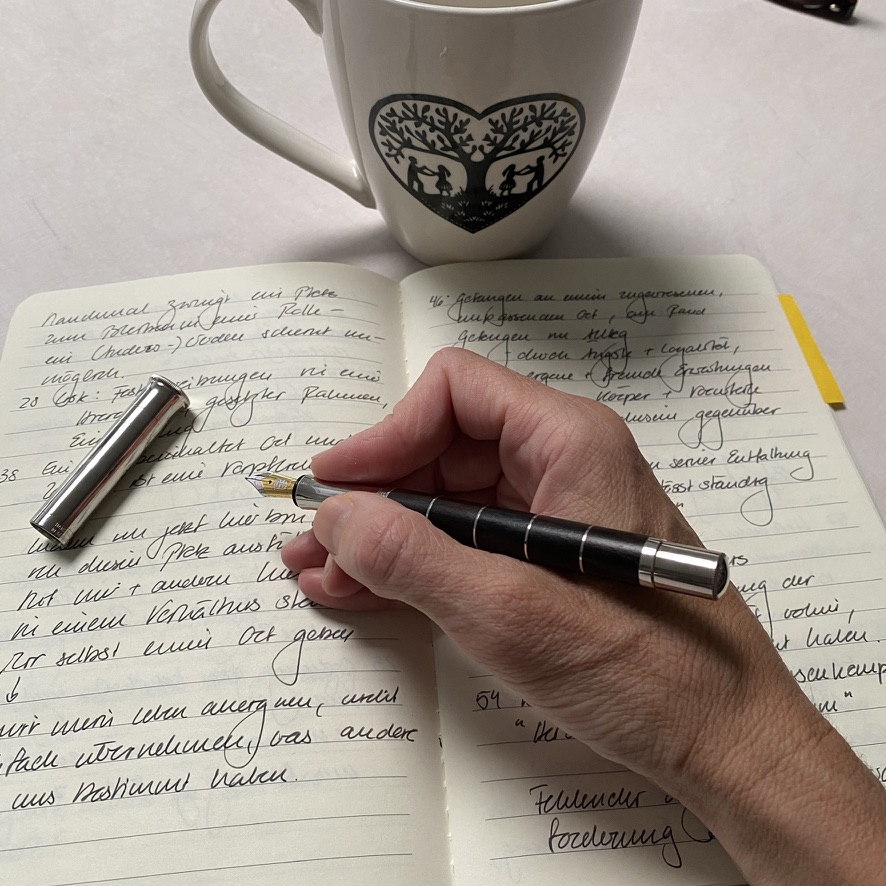« Es taumelt eine von Verdummung trunkene, verwahrloste Menschheit unter Ausschreien technischer und sportlicher Sensationsrekorde ihrem gar nicht mehr ungewollten Untergang entgegen»
Diese Worte wählte Thomas Mann 1955 in seinem «Versuch über Schiller anlässlich dessen 150. Geburtstag. Sie wären heute noch genauso passend, es scheint, die Welt ist, stillgestanden. Ich korrigiere: Die Welt hat sich (leider?) weitergedreht, doch wir Menschen sind stillgestanden und schauen ihr zu beim Untergang. Hier und da hört man ein schwaches «Man kann halt nichts tun.» Es erinnert mich immer an das «Man konnte halt nichts tun.» aus anderen Zeiten, aus dunklen Zeiten, aus Zeiten, aus denen wir offensichtlich wenig gelernt haben, schaut man sich in der Politik um.
Friedrich Schiller glaubte an die Moral, er glaubte an einen unbedingten Willen zur Moral, zu einer ästhetisierenden Moral. Indem der Mensch sich mit schöner Kunst beschäftige, finde er den Zugang zur Freiheit und zu vernünftigem Handeln, das auf moralischen Einsichten gründet. Das befördere nicht nur das Glück des Einzelnen, sondern das aller.
Thomas Mann attestierte Schiller einen
„Willen zum Schönen, Wahren und Guten, zur Gesittung, zur inneren Freiheit, zur Kunst, zur Liebe, zum Frieden, zu rettender Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst»
Und vielleicht ist das der Weg hin zu einer Welt mit weniger Angst, zu einer Welt mit mehr Miteinander, zu einer Welt, in der der Mensch Mensch ist und als solcher zählt als Gleicher unter Gleichen. Das wäre Freiheit. Das wäre Menschenwürde. Sie stehen allen zu.