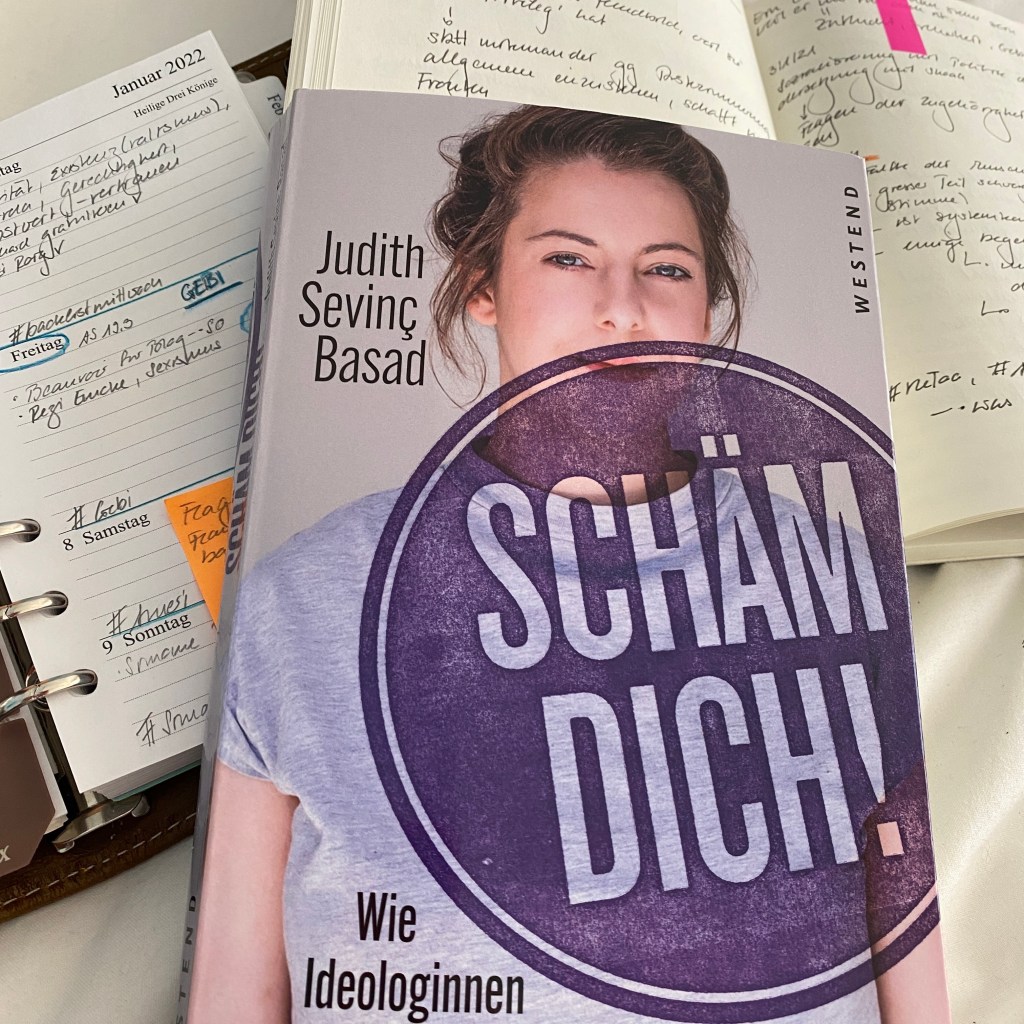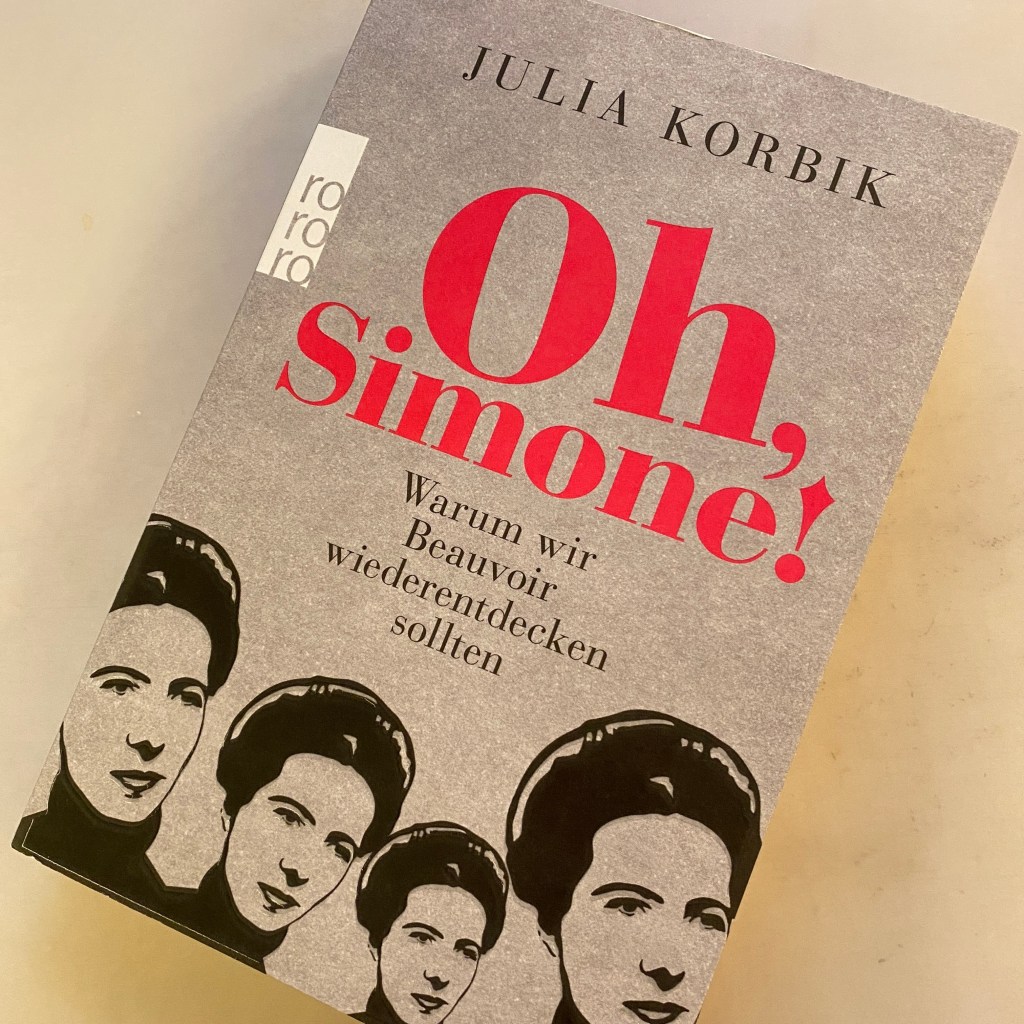Ein Monolog
Inhalt
«Ich schreibe, als ob ich murmeln würde: leise, mehr vor mich hin als schon an andere gerichtet. Es ist eher ein Nachdenken mit der Tastatur. Schreibend denkt es sich genauer.»
Die #MeToo-Debatte hat ein Thema zum Gespräch gemacht, das vorher totgeschwiegen wurde: Sexuelle Gewalt. Wie werden Machtstellungen missbraucht, um Menschen auszunutzen? Wo kommt diese Gewalt her und wie können wir die zugrundeliegenden Strukturen entlarven und aufbrechen? Wie können wir unsere Welt zu einer sichereren für alle machen, zu einer, in welcher wir gleichberechtigt miteinander leben?
Carolin Emcke nimmt sich diesen Fragen an, obwohl sie schon am Anfang weiss, dass es schwer sein wird, abschliessende Antworten zu finden. Anhand von persönlichen Erlebnissen und Analysen der Gesellschaft, versucht sie die komplexen Verhältnisse von Macht, Gewalt, Sexualität und Lust zu durchdringen. Entstanden ist ein Monolog, der zum Dialog mit dem Leser aufruft.
Weitere Betrachtungen
«Um etwas kritisieren zu können, muss man es sich vorstellen können und wollen. Um sich etwas vorstellen zu können, muss man es benennen können. Wenn Gewalt abstrakt bleibt, wenn es für sie keine konkreten Begriffe und Beschreibungen gibt, bleibt sie
unvorstellbar,
unwahrscheinlich,
unantastbar.»
Viele Themen werden todgeschwiegen, als denke man, sie existieren nicht, wenn man nicht darüber spricht. Dazu kommt, dass Themen wie Sexualität und sexueller Missbrauch mit Scham und oft auch Schuld behaftet wird. Das ist bei der einvernehmlich gelebten Sexualität schon schade, aber bei sexueller Gewalt ist es verheerend. Wenn Opfer von Missbrauchserfahrungen zum Schweigen verdammt sind, weil sie nicht wissen, wie und mit wem sie über ihre Erfahrung reden können, wenn sie keine Worte dafür haben, was passiert ist, keine Sprache, die Tat und Leid abbilden, bleiben sie damit allein, ungesehen, verletzt.
«Ist ahnungslos, wer erwartet, nicht gedemütigt zu werden?
Ist selbst schuld, wer erwartet, nicht belästigt zu werden?»
Zur Sprachlosigkeit kommt die Angst: Wenn Opfer von sexueller Gewalt befürchten müssen, dass ihnen nicht geglaubt wird, man sie selber oft zum (Mit-)Schuldigen macht, werden sie es sich zweimal überlegen, ob sie das tun sollen, da sie dadurch quasi einen zweiten Missbrauch erleben würden. Sexuelle Gewalt ist nie die Schuld des Opfers, egal, ob dieses einen kurzen Rock trug, sich in düsteren Etablissements aufhielt (zumal der häufigste Missbrauch im Freundes- und Familienkreis vorkommt) oder dergleichen. Sexueller Missbrauch ist ein Unrecht, ist eine begangene Tat von einem Täter, welcher allein die Schuld daran trägt. Solange dieses nicht endlich in allen Köpfen angekommen ist, werden Opfer sich zusätzlich zur Tat auch noch mit Schuld- und Schamgefühlen quälen.
«Ohne die Fähigkeit und Möglichkeit des Nachdenkens jenseits der eigenen Bedürfnisse, jenseits der eigenen Gruppe, Klasse, Lebensform, ohne das Entwickeln von Begriffen und Vergleichen zwischen unterschiedlichen Erfahrungen kann keine Gerechtigkeit, keine Anerkennung, keine Freiheit gedacht werden.»
Bei verschiedenen Diskriminierungsformen, sei es Sexismus, Rassismus oder die Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts, gibt es immer wieder Stimme, die finden, dass Ihnen nie etwas passiert sei. Das ist toll, nur hilft es denen, denen es passierte, nicht. Auch Vorschläge, man solle weniger empfindlich sein, sich halt wehren, alles nicht so eng sehen, gehen am Ziel vorbei, da ein strukturelles Unrecht ein Unrecht bleibt und nicht durch ein dickes Fell im Einzelfall zu beheben ist. Ob es wünschenswert ist, immer auf der Hut und im Abwehrmodus zu sein, weil es normal scheint, angegriffen zu werden, stellt sich als weitere Frage – ich denke nein. Wollen wir wirklich eine Welt, in der Gerechtigkeit und Freiheit Werte sind, die gelebt werden, brauchen wir den Blick aufs Grosse Ganze, über den eigenen Tellerrand hinaus. Wir brauchen die Empathie, uns in das Leid der Opfer von Diskriminierung hineinzufühlen und die Bereitschaft, Missstände verstehen zu wollen.
Persönlicher Bezug
«Ob wir nachhaltig etwas verändern, wird nicht zuletzt davon abhängig, ob Männer auch als Verbündete wahrgenommen und angesprochen werden…ob wir nachhaltig etwas verändern, wird auch davon abhängen, ob wir das Wir… immer wieder erweitern, damit sich mehr Menschen mit den unterschiedlichen Erfahrungen angesprochen fühlen.»
Ich mag keine Fronten, keine Grenzen – und doch sieht man sie, erlebt man sie immer wieder im Leben. Sobald du anders bist, sprich, von anderen als anders definiert wirst, womit sie sich implizit als Norm setzen, bist du auf der Gegenseite. Unser Weltbild ist so aufgebaut, das geht bis zu den weisen Griechen zurück und zieht sich durch die ganze (Philosophie)Geschichte. Zu denken, dass wir da einfach mal ausbrechen können, ist wohl eine Illusion. Und doch denke ich oft, es wäre der einzige Weg hin zu einem Miteinander, bei welchem ich immer denke: «Gemeinsam sind wir stark.» Wenn wir die Welt verändern wollen, die eine gemeinsame Welt sein soll (manchmal kommt es mir so vor, als ob jeder denkt, einer anderen Welt anzugehören, weswegen er sich locker abgrenzen kann), sollten wir unsere Kräfte bündeln.
Ich sehr heute oft das Gegenteil: Gruppierungen, die sich hohe Ziele wie Gerechtigkeit, Antirassismus, Antiklassismus, Antisemitismus, Sexismus, und mehr auf die Fahnen schreiben, schiessen locker gegen andere, obwohl eigentlich klar ist, dass alles zusammenhängt, dass all die Formen des Unrechts gegen Menschen ähnlichen Ursachen geschuldet sind und Menschen auch oft kumuliert treffen.
In der östlichen Philosophie herrscht das Bild, dass wir alle eins sind, dass alles miteinander verbunden ist, vor. Ein Bild ist, dass wir die Welt durch den Atem in uns aufnehmen und uns an die Welt abgeben. Ich mag dieses Bild. Nun ist es nicht so, dass alle Asiaten durch diese Philosophie friedliche Menschen wären, aber es kümmert sich ja auch nicht jeder um Philosophie im Alltag. Manchmal wäre es wünschenswert.
Fazit
Ein mitreissender, tiefgründiger, intelligenter Monolog über Gewalt und Missbrauch sowie unseren Umgang damit. Sehr empfehlenswert.
Autorin
Carolin Emcke, geboren 1967, studierte Philosophie in London, Frankfurt/Main und Harvard. Sie promovierte über den Begriff »kollektiver Identitäten«.
Von 1998 bis 2013 bereiste Carolin Emcke weltweit Krisenregionen und berichtete darüber. 2003/2004 war sie als Visiting Lecturer für Politische Theorie an der Yale University.
Sie ist freie Publizistin und engagiert sich immer wieder mit künstlerischen Projekten und Interventionen, u.a. die Thementage »Krieg erzählen« am Haus der Kulturen der Welt. Seit über zehn Jahren organisiert und moderiert Carolin Emcke die monatliche Diskussionsreihe »Streitraum« an der Schaubühne Berlin. Für ihr Schaffen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Theodor-Wolff-Preis, dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus, dem Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und dem Merck-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. 2016 erhielt sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Bei S. Fischer erschienen ›Von den Kriegen. Briefe an Freunde‹, ›Stumme Gewalt. Nachdenken über die RAF‹, ›Wie wir begehren‹, ›Weil es sagbar ist: Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit‹ sowie ›Gegen den Hass‹.
Angaben zum Buch
Herausgeber: S. FISCHER; 3. Edition (22. Mai 2019)
Gebundene Ausgabe: 112 Seiten
ISBN-Nr.: 978-3103974621
Zu kaufen in jeder Buchhandlung vor Ort und online u. a. bei AMAZON.DE und ORELLFUESSLI.CH