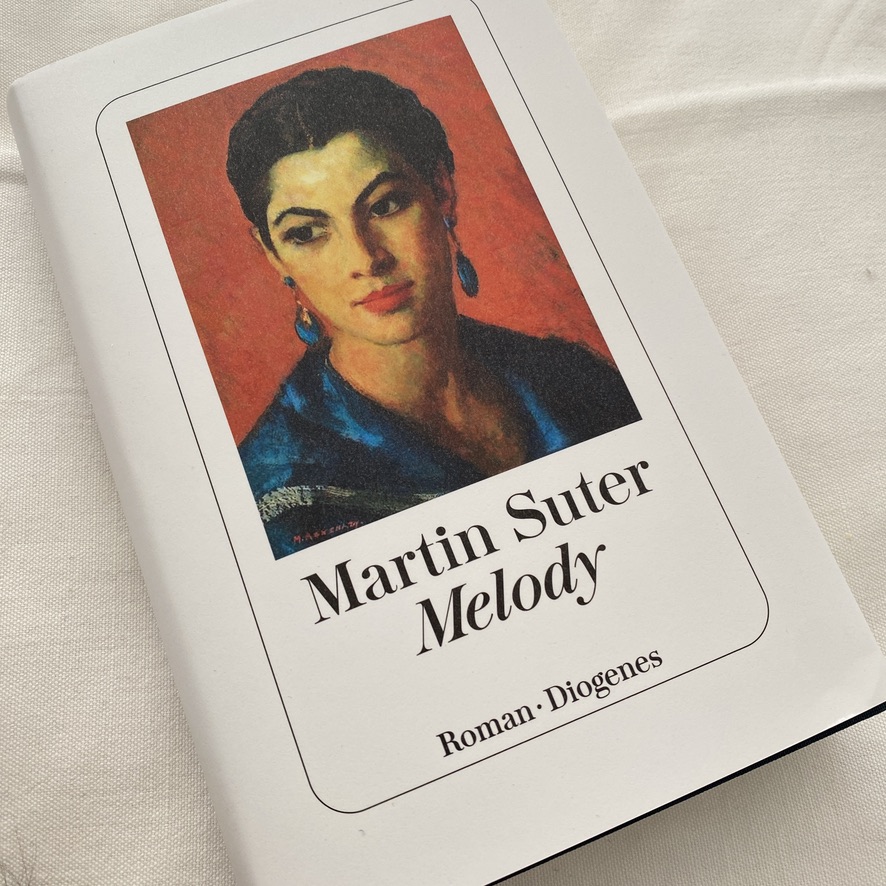Lieber Papa
Kürzlich las ich in einem Buch dieses Zitat:
«Ich war so traurig an diesem Abend; ich begriff mit einer Klarheit, wie nur zu wenigen anderen Zeiten meines Lebens, dass die Isolation meiner Kindheit, die Angst und die Einsamkeit, mich nie ganz loslassen würden. Meine Kindheit war ein einziger Lockdown gewesen.»
Elizabeth Strout
Weisst du, wie einsam ich mich oft fühlte als Kind? Von klein an? Immer jemandem im Weg. Immer von jemandem nicht gewollt. Da gab es diesen Tag, als Mama mir sagte:
«Ich weiss, dass Papa dich lieber hat als mich.»
Das kam aus dem Nichts. Es war eine einzige Anklage. Ich stand da. Wusste nicht, was ich falsch gemacht hatte. Wie mir geschieht. Ich fühlte mich schuldig. Und traurig. Und allein. Ich hatte ihr etwas weggenommen. War das der Grund, dass sie mir gegenüber immer so distanziert war? Konnte sie mich drum nicht lieben? Weil ich ihre Feindin war? Nahm sie mich darum nie in den Arm? Fühlte sich darum alles, was sie tat, an, als erfülle sie eine Pflicht? Ich meine: Äusserlich ging es mir immer gut. Ich war warm angezogen, hatte zu essen, sie «kümmerte sich». Sie war eine Kümmermutter, keine liebende.
Vielleicht war das die gerechte Strafe für mich. Mich konnte man nicht lieben. Weil ich böse war. Ich stahl anderen die Liebe. Ich hatte keine Ahnung, aber ich versuchte, alles wieder gut zu machen. Ich wollte, dass sie glücklich ist. Und ich wollte, dass sie mich liebt. Ich versuchte, mich von dir fernzuhalten. Das war schwer, denn du warst alles, was ich hatte. Du warst der einzige, bei dem ich dachte, er wolle etwas mit mir machen. Und ich war gerne mit dir zusammen. Ich habe die Aussage nie mehr vergessen. Von da an fühlte ich mich immer zwischen den Stühlen. Ich wusste nicht, dass es noch schlimmer kommen könnte.
Erinnerst du dich? Wir fuhren zusammen zum Einkaufen. Mama und ich hatten mal wieder Streit gehabt. Keine Ahnung, weswegen. Du hast mir diesen Streit übelgenommen. In deinen Augen war ich dafür verantwortlich. Das war ich immer, wenn irgendwo etwas nicht gut lief. Das war immer nur so, weil ich war, wie ich war.
Ich erinnere mich so gut an alles. Du warfst mir an den Kopf, dass Mama wunderbar sei, dass sie alles für mich mache. Du schimpftest mich undankbar. Ich müsse mich ändern, weil es so nicht weitergehen könne. Und dann sagtest du diesen Satz, der mein ganzes Leben mit einem Schlag in Frage stellte:
«Deine Mutter ist mir das Wichtigste. Wenn du nicht endlich mit ihr klarkommst, kannst du gehen. Dann will ich dich nicht mehr hier haben.»
Kein Schlag, keine Ohrfeige hätte mich mehr treffen können.
Das war der Tag, an dem ich gefühlt alles verloren habe und keinen Sinn mehr sah im Leben. An diesem Abend sammelte ich alle Schlaf- und Schmerzmittel zusammen, die ich im Haus finden konnte. Es waren viele. Ich schluckte sie. Es sollte endlich alles vorbei sein. Ich schlief ein.
Erst viele Stunden später und mit viel Anstrengung habt ihr mich wieder einigermassen wach gekriegt. Mir war übel. Ich stand neben mir. Alles drehte sich. Die Beine wollten mich nicht mehr tragen. Aber ich lebte. Leider. Nur in mir war etwas gestorben.
(«Alles aus Liebe», XXXVI)