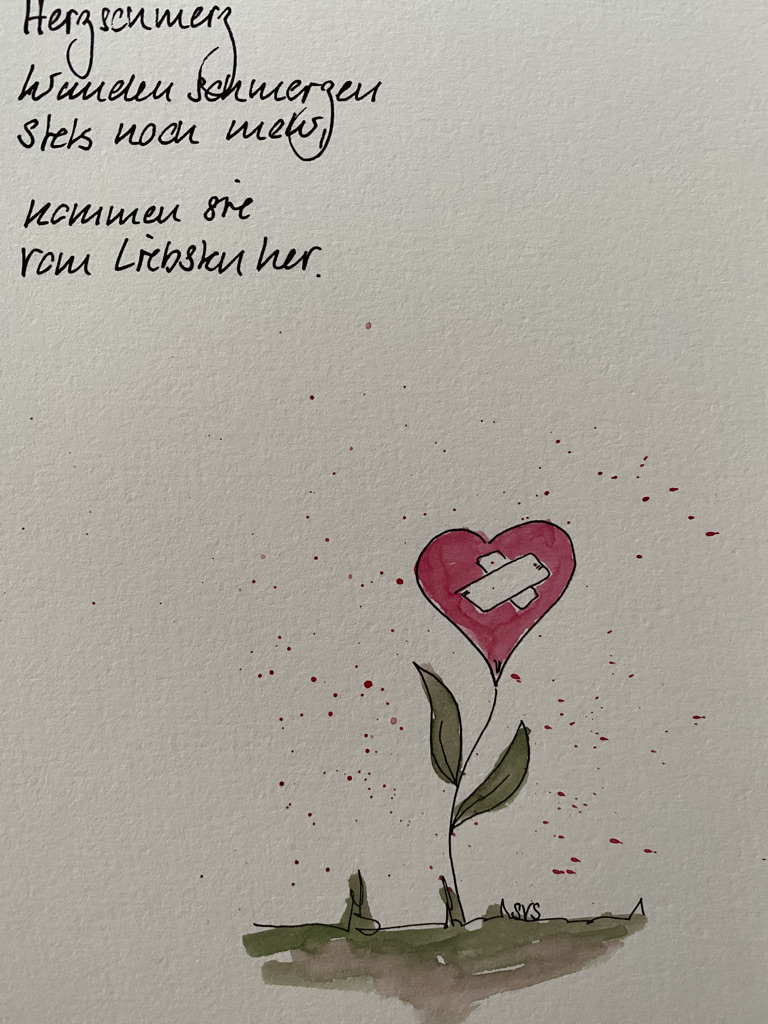Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren,
Weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid,
Vergnüge dich an dir und acht es für kein Leid,
Hat sich gleich wider dich Glück Ort und Zeit verschworen.
Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren,
Nimm dein Verhängnis an, lass alles unbereut.
Tu, was getan muss sein, und eh man dir’s gebeut.
Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren.
Was klagt, was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke
Ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an:
Dies alles ist in dir. Lass deinen eitlen Wahn,
Und eh du förder gehst, so geh in dich zurücke.
Wer sein selbst Meister ist und sich beherrschen kann,
Dem ist die weite Welt und alles untertan.
Schon am Anfang zeigt sich das Programm des Gedichtes. In einem kleinen Wort steckt schon so viel drin: Dennoch. Sei dennoch unverzagt. Selbst wenn alles nicht so läuft, wie das willst, wenn das Leben schwer ist, selbst dann sei unverzagt. Und gib dennoch nicht alles schon verloren, denn das ist es nicht. Hüte dich vor Neid dem Glücke anderer gegenüber und schau es nicht als Leid an, wenn dir selbst das Glück gerade nicht hold ist.
Was aber ist Glück und wie kommt man dahin? Wie kommt man mit einer Welt klar, in der die Dinge nicht immer so laufen, wie man sich das wünscht? Mit Gelassenheit, sagt Paul Fleming. Indem wir davon ausgehen, dass alles seine Bestimmung und seine Gründe hat, dass wir annehmen müssen, was ist. Und bei all dem sollen wir die Hoffnung nie verlieren, dass nach einem Unglück auch wieder bessere Zeiten kommen.
All die Klagen sind schlussendlich unnötig. Auch das Loben des Glücks ist es. Statt das Glück im Aussen zu suchen, solle man in sich gehen, denn: Alles ist schon da. Es liegt allein an mir selber, ob ich das Glück finde oder nicht, denn es liegt genau darin, was oben schon beschrieben ist: Annehmen was ist und sich nicht in Neid und Wehklagen zu verstricken. Dann ist man Herr seiner Gefühle, dann ist man Herr seiner selbst und steht damit über allem, was bedrücken könnte.
Paul Fleming hat dieses Gedicht 1641, also vor 380 Jahren geschrieben, in einer Zeit, die durch den 30-jährigen Krieg und die Pest stark gebeutelt war. Das Leben war kein sicherer Wert, es war jederzeit in Gefahr. Mit seiner Form (Sonett mit 14 Versen, aufgeteilt in zwei Quartette und zwei Terzette, mit sechshebigem Jambus (Alexandriner), abwechselnd weiblichen und männlichen Kadenzen sowie dem umarmenden, in den Terzetten durch zwei Paarreime unterbrochenen, Reim) ist das Gedicht typisch für seine Entstehungszeit, den Barock. In der Lebensauffassung dieser Zeit bildeten sich Gegensätze wie «Carpe diem – Memento mori», «Diesseits – Jenseits» heraus, Gegensätze, denen immer die Vergänglichkeit des Lebens eingeschrieben war. Ebenfalls präsent war der Glaube an die Vorbestimmung eines Lebens, daran, dass dieses dem Menschen quasi vorgezeichnet ist und es kein Entrinnen gibt.
Diese Lebensauffassungen mögen heute nicht mehr gelten, dennoch hat das Gedicht nichts von seiner Aktualität und Wahrheit eingebüsst. Noch heute ist der Mensch in seinem Streben nach Glück gleich, noch heute wird er aber einsehen müssen, dass er nur eines selber in Händen hat: Wie er auf die Dinge reagiert, welche das Leben bereit hält. Wenn es da gelingt, aus einem Gleichmut und einer Gelassenheit heraus anzunehmen, was ist, dann stellt sich eine Ruhe ein und damit auch eine Art Glück.
______________________
Paul Fleming, geboren am 5. Oktober 1609 in Hartenstein (Sachsen) und gestorben am 2. April 1640 in Hamburg, war Arzt und Schriftsteller und gilt als einer der bedeutendsten Lyriker der deutschen Barockliteratur. Er schrieb sowohl lateinische wie auch deutsche Gedichte, wobei nur wenige lateinische Gedichte schon zu Lebzeiten veröffentlicht wurden.