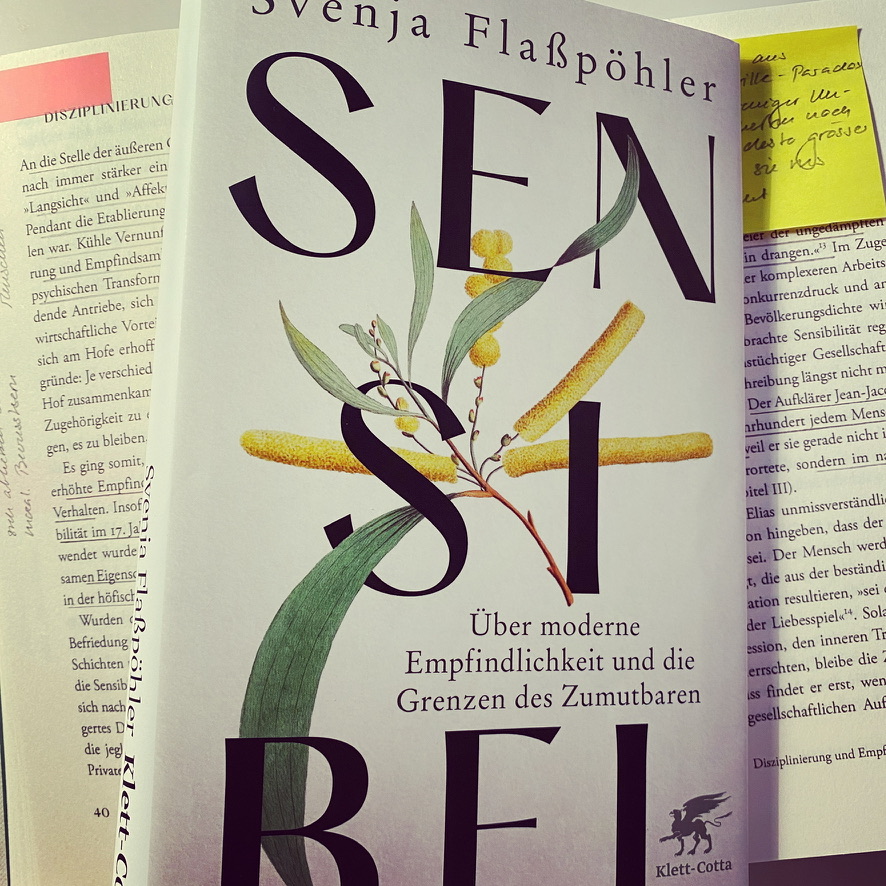Wir werden in eine Welt geworfen, die wir uns nicht ausgesucht haben und die nicht auf uns gewartet hat. Wir wachsen in diese Welt hinein, lernen, wie sie funktioniert, was von uns erwartet wird. Je nach Kultur und Zeit und sozialem Umfeld sehen diese Erwartungen anders aus, was überall gleich ist: Wir sollten sie erfüllen. Doch was, wenn sich diese Erwartungen nicht passend anfühlen? Was, wenn wir es nicht schaffen, sie zu erfüllen? Was, wenn wir uns fremd in dieser Welt fühlen, die doch die unsere ist, entfremdet von der Welt durch unser und in unserem Sein?
„Ob Leben gelingt oder misslingt, hängt davon ab, auf welche Weise Welt (passiv) erfahren und (aktiv) angeeignet oder anverwandelt wird und werden kann…Zentral ist die Idee einer Differenz zwischen gelingenden und misslingenden Weltverhältnissen, die sich nicht am Ressourcen- oder Verfügungsreichtum und auch nicht an der Weltreichweite festmachen lässt, sondern am Grad der Verbundenheit mit und der Offenheit gegenüber anderen Menschen (und Dingen).“ *
Eine Welt, die wir als für uns passend wahrnehmen, muss etwas in uns zum Klingen bringen. Wir müssen eine Verbindung wahrnehmen, etwas, an das wir mit unserem Sein anknüpfen können. Wir müssen in unserem So-Sein die Welt als etwas erfahren, in dem wir aufgehoben sind, das uns etwas angeht, weil sie zu uns spricht.
„Subjektivität [entsteht] immer schon aus und in einer Bezogenheit auf Welt… Subjekte erfahren sich als in eine Welt gestellt, die sie etwas angeht, und dieses ‚Angehen‘ ist von positiver oder negativer Bedeutsamkeit. Die Dinge sprechen uns an oder sagen uns zu – oder sie stossen uns ab; wenn uns etwas nichts sage, so impliziert dies, dass wir keine Beziehung dazu haben.“*
Wir leben als Individuen nie unabhängig von der Welt, unser Selbst bestimmen wir immer relational zur Umwelt. Egal, ob uns diese gefällt oder eher abstösst, wir setzen uns dazu in Bezug und schaffen aus dieser Beziehung unser Selbstbild. Diese Bestimmung ist allerdings nicht für immer festgesetzt, sie ist nicht in Stein gemeisselt, sondern sie kann sich über die Zeit auch verändern.
„Weltbeziehungen sind stets dynamisch, sie konstituieren sich in und durch die prozesshaften Begegnungen von Subjekt und Welt.“*
Das hängt damit zusammen, dass sich die Welt verändert durch das, was tagtäglich in ihr vorgeht, aber auch, weil wir uns selber verändern – besonders stark im Heranwachsen, aber auch später noch. Je nach Lebensabschnitt befinden wir uns an einer anderen Stelle in unserem Sein und damit auch in einer anderen Rolle in der Welt, die uns umgibt. Einerseits haben wir andere Bedürfnisse an diese je nach Lebensplan, andererseits hat auch sie andere Erwartungen an uns. Dieses Zusammenspiel von Erwartungen und Anpassungen, von Beziehungsgefügen ist ein dynamisches, aber in dieser Dynamik kontinuierlich wandelndes.
Die Frage nach dem eigenen Sein, nach dem gelingenden Leben, kann nie im luftleeren Raum gestellt werden. Wir sind als soziale Wesen in eine Welt und ein menschliches Umfeld eingebettet, mit dem wir in einer irgendwie gearteten Beziehung stehen. Einerseits prägt uns dieses Umfeld, andererseits wollen wir uns in diesem Umfeld behaupten als die, die wir sind. Wir wollen ein Leben leben, das dem entspricht, das wir für uns als die, als die wir uns sehen, passend erachten.
Fühlen wir uns mit diesem Lebensentwurf nicht mehr zur Welt passend, kommt es zu einem Gefühl von Entfremdung. Zwar können wir uns nicht aus der Beziehung zu dieser Welt lösen, doch wir können sie auch nicht leben. Wenn wir uns zu sehr in die Welt einfügen, kann es dazu führen, dass wir uns von uns selbst entfremden. Ein gelingendes Leben kann also nur dann stattfinden, wenn zwischen uns und der Welt eine Beziehung besteht, die lebt.
„Die Vorstellung, dass Menschen selbstinterpretierende Wesen sind, impliziert, dass ihre Weltbeziehungen niemals schlechthin gegeben sind, sondern in individuellen und kulturellen Deutungsprozessen stetig artikuliert, re-konstituiert, verhandelt und transformiert werden. Sie bedeutet zugleich, dass Selbstinterpretation immer und notwendig auch Weltinterpretationen sind und umgekehrt.“*
Nun ist die Welt nicht einfach gesetzt im Sinne einer unveränderlichen objektiven Grösse. Die Welt ist immer auch das, was wir in ihr sehen, wie wir sie deuten, interpretieren. Insofern schaffen wir uns unsere Welt zu einem Stück selber durch die Perspektive, die wir ihr gegenüber einnehmen. Um also zu einem gelingenden Leben innerhalb der Welt um uns zu gelangen, bedarf es eines offenen Blickes auf diese Welt. Wir müssen bereit sein, uns von der Welt berühren zu lassen. Wir müssen sie mit all ihren Möglichkeiten und von verschiedenen Seiten betrachten und nach Antworten suchen auf unser Fragen an das Leben und die Welt. Wo finden wir einen Resonanzrahmen, wo die Möglichkeit, uns mit unseren Bedürfnissen wahr- und angenommen zu fühlen? Ebenso müssen wir offen bleiben gegenüber den Bedürfnissen der Menschen um uns und auf diese antworten. Erst durch dieses gegenseitige In-Beziehung-Treten, das sich als gegenseitige Anerkennung*** äussert, wird ein gelingendes Leben als soziale Menschen in einer gemeinsamen Welt möglich.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass für ein gelingendes Leben zuerst ein Selbstbild nötig ist, welches wir durch unseren Weltbezug und unsere Bedürfnisse für unser in der Welt Sein festlegen. Zweitens bedarf es eines aktiven In-Beziehung-Tretens, indem wir nach Antworten suchen und im Gegenzug auch auf die Welt antworten, so dass ein Resonanzraum entsteht. Durch diese Interaktion des gegenseitigen Aufeinander-Beziehens, durch die gegenseitige Anerkennung, verhaften wir uns in der Welt als selbstbestimmte Wesen, die gemeinsam mit anderen als je eigenständige und selbstbestimmte Wesen an dieser Welt partizipieren.
*Zitate aus: Hartmut Rosa, Resonanz
**mehr zum Thema Entfremdung: Rahel Jaeggi, Entfremdung
***mehr zum Thema Anerkennung: Axel Honneth
Buchtipps zum Thema
- Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Suhrkamp Verlag, Berlin 2016.
- Rahel Jaeggi: Entfremdung, Suhrkamp Verlag, Berlin 2016.
- Axel Honneth: Kampf um Anerkennung, Suhrkamp Verlag, Berlin 2016.