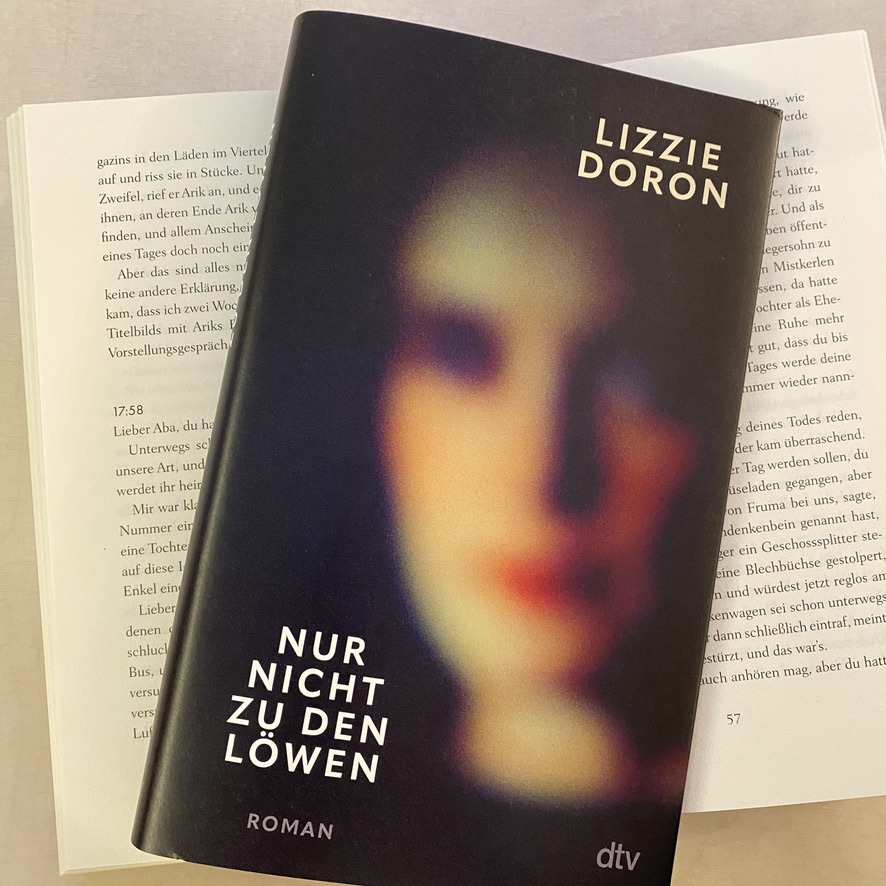Inhalt
«Ich kann nicht anders als mich zu fragen: Wie ist es möglich, dass ich hier bin? Niemand hatte je daran geglaubt, dass ich hier landen würde. Den ganzen Sommer über haben Erwachsene zu mir gesagt, wie viel ‘Glück’ ich hätte, ‘so eine Gelegenheit zu bekommen’, immer hoben sie mein Glück hervor, ohne anzuerkennen, wie hart ich dafür gearbeitet habe.»
Tess kämpft sich mit Ehrgeiz und viel Arbeit durch die sozialen Schichten, kann mit einem Stipendium in Cambridge studieren und später in eine angesehene Kanzlei in London eintreten. Sie merkt, dass sie aus einer anderen Klasse stammt, es wird ihr überall bewusst: «Weil man mir anmerkt, dass ich nicht hierher gehöre.»
Sie versucht, sich anzupassen, die Verhaltensweisen anzueignen, die es braucht, um dazuzugehören, und sie verschafft sich Respekt durch ihre Leistung und ihr Können. Alles läuft auf graden Schienen, bis ein einziger, verhängnisvoller Abend alles zunichtezumachen scheint und ihre ganze Welt aus den Fugen gerät. Was soll sie tun? Was steht auf dem Spiel? Ist sie bereit, den Preis für ihre Überzeugungen zu bezahlen?
Gedanken zum Buch
Es gibt Bücher, die gehen tief. Die bewegen, die erschüttern, die verstören. Sie dringen in dein Innerstes und wühlen es auf. Das ist mir mit diesem Buch so gegangen. Hatte ich am Anfang noch Mühe, reinzukommen, weil mir der Stil nicht entsprach – zu kalt, zu sachlich, zu erklärend, zu aufzeigend, zu wenig persönlich -, wurde ich nach und nach reingezogen, immer mehr, immer tiefer. Und ich merkte, dass genau dieser Stil am Anfang wichtig war. Er zeigte etwas, eine Haltung, eine Rolle, ein Konstrukt, das Risse bekam, das erschüttert wurde. Durch einen Abend. Durch ein Erlebnis.
«Vielleicht sind Leute wie ich nur besonders empfänglich für diesen Ton, den Männer in Machtpositionen anschlagen, wenn sie an einem zweifeln. Es ist schwer zu erklären, wenn man die leichte Herabsetzung nicht selbst wahrnimmt.»
Suzie Miller hat einen Roman geschaffen, der die sozialen Unterschiede und die Klassenschranken in den Blick nimmt. Sie zeigt auf, wie verschieden die Lebenswirklichkeiten in unterschiedlichen Klassen aussehen, erzählt davon, welche Abgründe es zu überwinden gilt, will man sich in einer anderen Klasse als der der eigenen Herkunft bewegen. Es sind oft subtile Kleinigkeiten, und doch können sie ganze Lebenswege definieren.
«Prima facie- lat. Für dem Anschein nach, auf den ersten Blick.»
Das Buch gewährt Einblicke in das Rechtssystem und die diesem zugrunde liegenden Prinzipien und Strategien. Was für das Recht gilt, zieht sich aber oft auch durch das normale Leben. Recht und Leben wirken aufeinander, bedingen einander, beeinflussen sich gegenseitig. Wie oft urteilen wir danach, wie etwas auf den ersten Blick scheint? Wir gehen aus von den vorgefertigten Bildern in unserem Kopf, die meist ein Relikt einer jahrelangen Prägung durch ein System sind, in dem wir gross wurden und das uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir nehmen diese Vor-Verurteilung nicht mehr wahr, wir glauben, die Welt zu sehen, wie sie ist, und sehen doch immer nur die Welt, wie wir sie sehen, weil wir sind, wie wir sind, wie wir geworden sind.
Dieses Buch ist ein Augenöffner. Es zeigt, wie wir uns in Systeme hineinziehen lassen und sie oft fraglos übernehmen, weil uns die passenden Argumente, die sie stützen, gleich mitgeliefert werden und überzeugen. Es heisst nicht, dass diese Systeme grundsätzlich falsch sind, dass sie nicht eine Möglichkeit sind, wie die Welt gesehen werden kann, aber sie sind eben genau das: Eine Möglichkeit und nicht die absolute Wahrheit und einzige Sicht.
Am Schluss dieses Buches sassen die Tränen locker. Es ist ein Buch, das sich setzen muss, das nachhallt. Eine grosse Leseempfehlung.
Fazit
Ein wichtiges Buch, ein Buch, das aufzeigt, wie viel vom Patriarchat in unseren Systemen steckt und wie wir uns dem immer wieder unterwerfen. Sehenden Auges. Es zeigt, was es heisst, Mut zu haben, hinzustehen, aufzubegehren. Und wie wichtig es ist.
Zur Autorin und zur Übersetzerin
Suzie Miller, geboren in Melbourne, hat Jahre lang als Strafverteidigerin gearbeitet, mit besonderem Augenmerk auf sexuellen Missbrauch. Ihr Stück, auf dem ihr Roman basiert, gewann alle großen Preise Australiens sowie den Olivier Award, die wichtigste Auszeichnung im britischen Theater. »Prima facie« ist ihr erster Roman.
Katharina Martl, geboren 1987, übersetzt aus dem Englischen und den festlandskandinavischen Sprachen. Sie lebt in München.
Angaben zum Buch
- Herausgeber : Kjona Verlag; 1. Edition (29. Januar 2024)
- Sprache : Deutsch
- Gebundene Ausgabe : 352 Seiten
- ISBN-13 : 978-3910372214
- Originaltitel : Prima facie