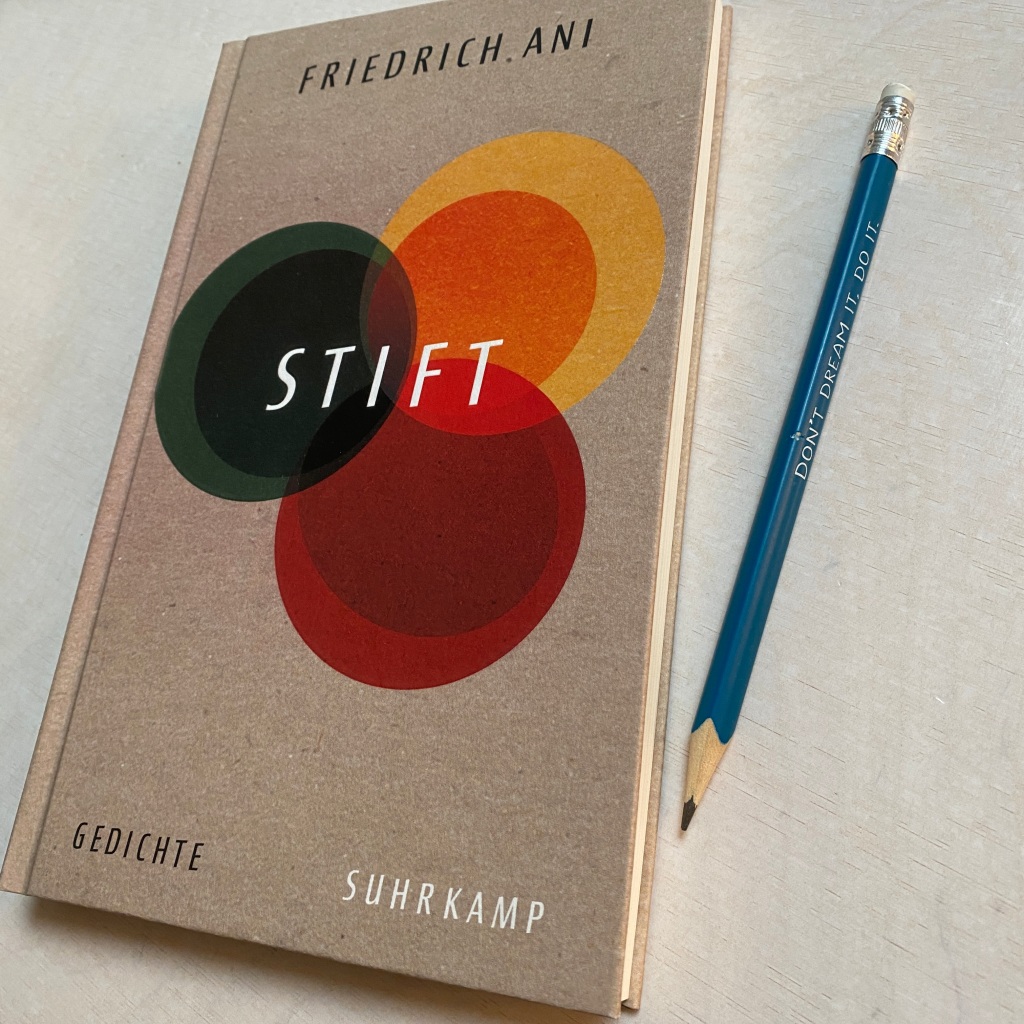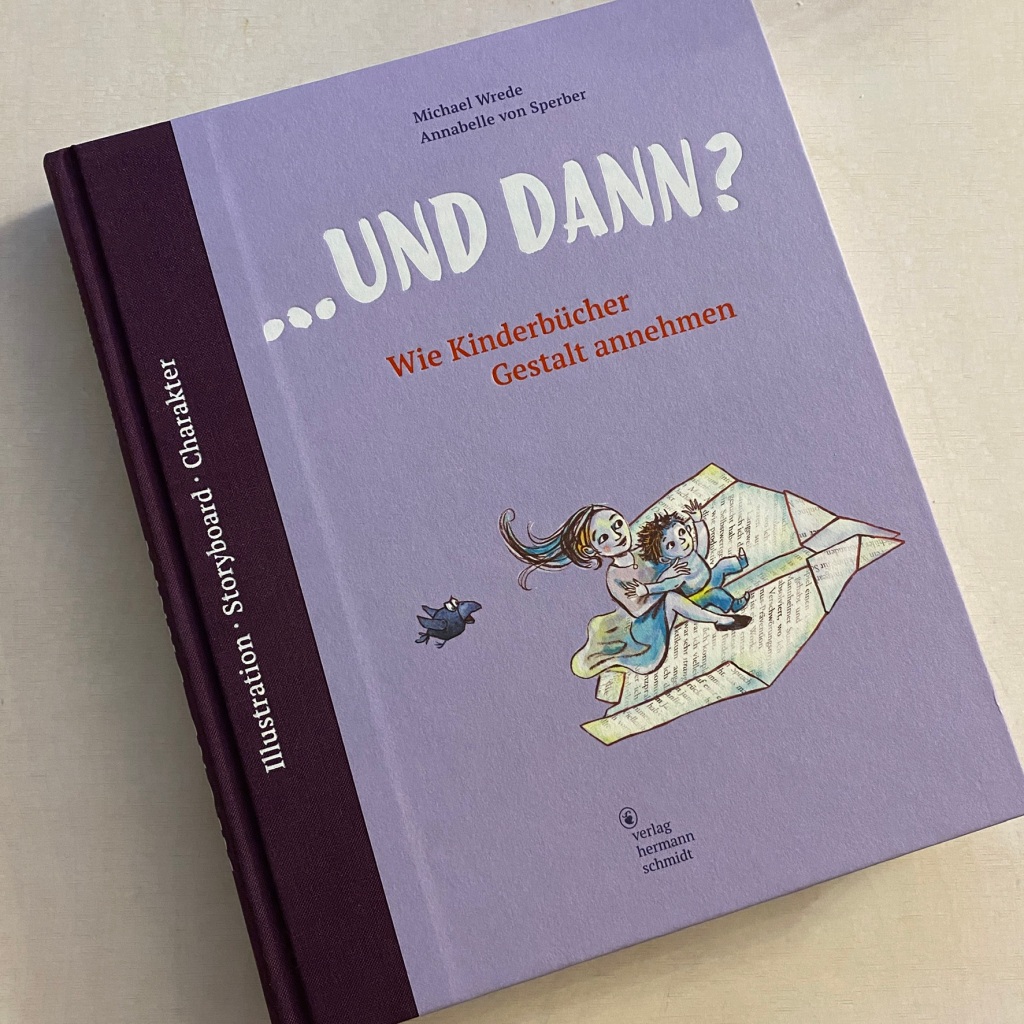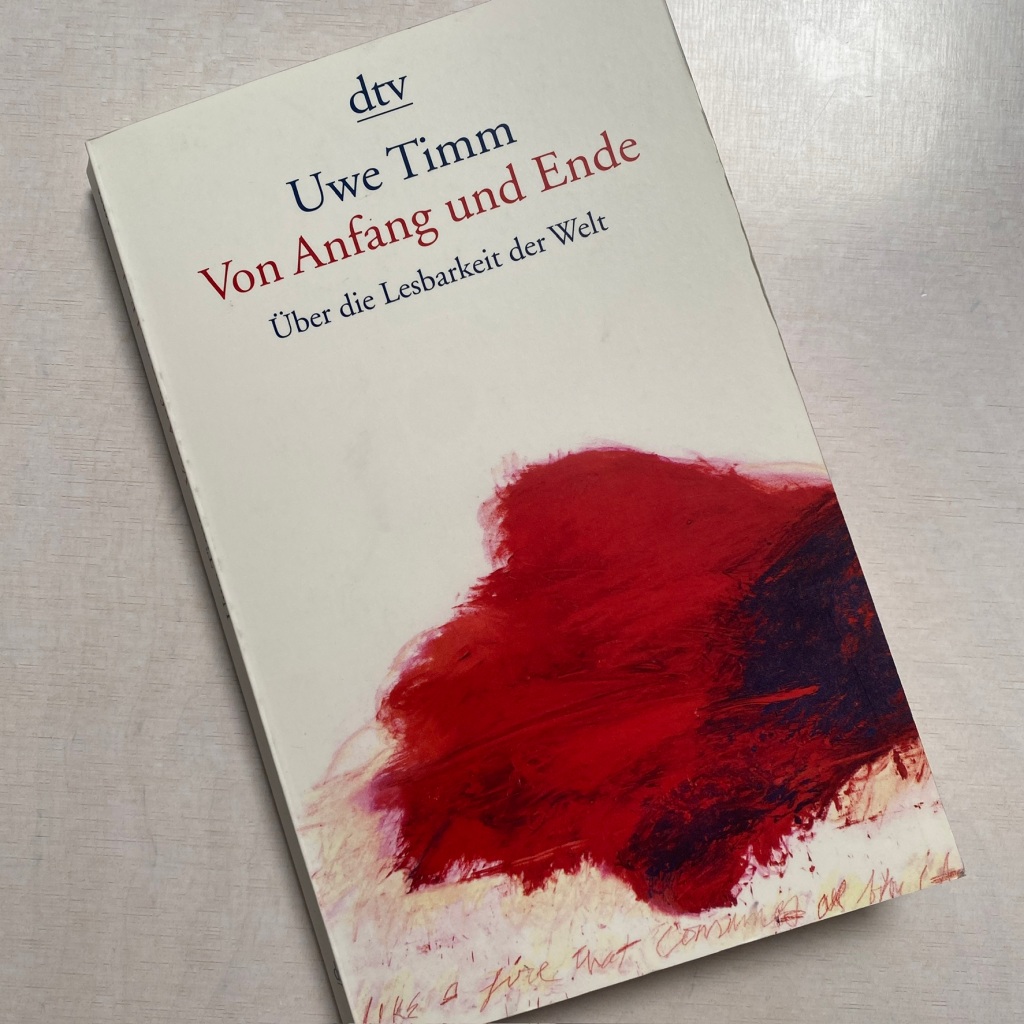Ivar Leon Menger, 1973 in Darmstadt geboren, ist Schriftsteller, Diplom-Designer, Werbetexter, Hörspielautor und Regisseur. Bekannt wurde er durch seine erfolgreichen Audible-Hörspielserien Ghostbox und Monster 1983, für die er 2023 mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. 2022 erschien sein Thrillerdebüt Als das Böse kam, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde und für den französischen Krimipreis 2025 nominiert ist, ein Jahr darauf sein zweiter Thriller Angst. Sein dritter Roman Finster ist SPIEGEL-Bestseller.
Wer bist du? Wie würdest du deine Biografie erzählen?
Meine Biografie ist eine Achterbahnfahrt, die für einen Roman taugen könnte. Nach dem Abitur habe ich Grafikdesign studiert und dabei meine Liebe für den Film entdeckt. Da mein Vater mir kein zweites Studium finanzieren wollte, habe ich fünf Jahre als Werbetexter gearbeitet, um Schreiben zu lernen. In dieser Zeit habe ich meinen ersten Kurzfilm gedreht, der auf der Berlinale ausgezeichnet wurde. Daraufhin habe ich meinen sicheren Job gekündigt und in einer Videothek gejobbt und an meinem nächsten Kurzfilm gearbeitet. Dieser Film hat glücklicherweise einen Regie-Award bei ProSieben gewonnen und ich durfte einen 20:15 Uhr Film mit Bjarne Mädel drehen. Dafür bin ich extra nach Berlin gezogen. Doch zwei Wochen vor Drehbeginn haben sich die Produktionsfirma und der Sender zerstritten und das Projekt ist gestorben. Ich wusste nicht weiter. Ein befreundeter Synchronsprecher, Jan-David Rönfeldt, hat daraufhin aus meinem Episodendrehbuch «Der Prinzessin», das ich kurz zuvor geschrieben hatte, ein Hörspiel produziert. Für die Rolle des Stalkers habe ich Jens Wawrczeck gewonnen, der bei der Hörspielreihe «Die drei ???» Peter Shaw spielt. Jens hat mich dann wiederum als Autor bei Sony/Europa empfohlen und so kam ich zum Hörspiel. Und dort blieb ich über fünfzehn Jahre lang. Im Jahr 2021 habe ich dann meinen Debütroman „Als das Böse kam“ geschrieben und wechselte in den Literaturbereich.
Das ist jetzt ein etwas längerer Text geworden, und doch ist es nur die Kurzversion.
Wieso schreibst du? Wolltest du schon immer Schriftsteller werden oder gab es einen Auslöser für dein Schreiben?
Ich habe schon immer Geschichten erfunden und erzählt. Es begann in meiner Kindheit, wenn Freunde bei mir übernachtet haben. Dann habe ich mir gruselige Märchen ausgedacht und sie im Dunkeln erzählt. Einmal hat sich ein Freund so sehr gefürchtet, dass er von seinen Eltern wieder abgeholt werden wollte. Da wusste ich, das sollte ich beruflich machen.
Es heisst, Ideen liegen auf der Strasse, doch nicht jeder sieht dasselbe, interessiert sich für dasselbe. Wo findest du generell deine Ideen?
Meine Ideen finde ich tatsächlich im Alltag. Gespräche am Nachbartisch, in der Tageszeitung oder erlebte Situationen mit meiner Familie, in denen ich mich frage: Was wäre, wenn jetzt die Tür aufgehen würde und dann …
Wenn du auf deinen eigenen Schreibprozess schaust, wie gehst du vor? Entsteht zuerst ein durchdachtes Gerüst, ein Konvolut an Notizen oder aber schreibst du drauflos und schaust, wo dich das Schreiben hinführt?
Wenn ich eine Idee für einen besonderen Twist, ein ungewöhnliches Ende oder die Ausgangssituation für den ersten Akt habe, dann fange ich an zu schreiben. Ich mache mir keinen Plan. Ich bin kein Plotter, sondern schreibe, was aus meinem Bauch, Herz und Kopf kommt. Erst ab dem dritten Akt mache ich mir Gedanken, wie ich alle Fäden zusammen- und zu einem überraschenden Ende bringe.
Wie sieht es mit dem Schreibmaterial aus? Schreibst du den ersten Entwurf von Hand oder hast du gleich in die Tasten? Wenn von Hand, muss es dieser eine Füller sein oder das immer gleiche Papier?
Ich schreibe auf einer elektrischen Schreibmaschine. Meiner geliebten Hemingwrite. Die hilft mir, in den Flow zu kommen und nicht ständig während des Schreibprozesses zu editieren. Danach überarbeite ich den Text kapitelweise auf dem MacBook, mit der Software Papyrus.
Ich hörte mal, der grösste Feind des Schriftstellers sei nicht mangelndes Talent, sondern die Störung durch andere Menschen. Ich glaube, du würdest dem zustimmen?
Tatsächlich kann ich kaum bis gar nicht im Zug oder in Cafés schreiben. Ich mag es nicht, wenn mir jemand beim Arbeiten zusieht. Ich brauche einen kleinen Raum für mich selbst. Manchmal schreibe ich mit absoluter Stille, manchmal auch mit Film- oder klassischer Musik.
Thomas Mann hatte einen strengen Tagesablauf, in dem alles seine zugewiesene Zeit hatte. Wann und wo schreibst du? Bist du auch so organisiert oder denkst du eher wie Nietzsche, dass aus dem Chaos tanzende Sterne (oder Bücher) geboren werden?
Ich habe tatsächlich keinen strengen Tagesablauf. Morgens schreibe ich jedoch am liebsten. Aber nicht täglich. Es kommt vor, dass ich vier Tage lang Pause mache und nicht an der Schreibmaschine sitze, weil andere Projekte Vorrang haben. Wie zum Beispiel eine längere Buchhandelsreise oder eine Hörspielproduktion. Ich komme aber immer wieder in meine Texte rein, sogar wenn ich sechs Wochen lang nicht daran geschrieben habe. Ich vertraue in die geistige Welt, in meine Musen, die mich beim Schreiben unterstützen.
Was sind für dich die Freuden beim Leben als Schriftsteller, was bereitet dir Mühe?
Meine Freuden als Schriftsteller sind definitiv, dass ich schreiben kann, wann und wo ich möchte. Ich brauche nichts anderes als meine Schreibmaschine. Das ist wahres Glück.
Hat ein Schriftsteller je Ferien oder Feierabend? Wie schaltest du ab?
Ich schalte niemals ab. Zumindest nicht unbewusst. Überall wittere ich eine Geschichte, ein Kapitel oder eine Szene – halte Augen und Ohren offen. Aber das ist ja das Schöne an unserer Berufung.
Dein Weg führte vom Design-Studium über die Werbung (Vaters Fussstapfen?) hin zu Hörspielen. Dann kamen erste Bücher. Was treibt dich immer weiter? Und: Wohin geht es nun?
Im Literaturbetrieb gefällt es mir ausserordentlich gut. Hier fühle ich mich zuhause, angekommen. Wenn es nach mir geht, möchte den Rest meines Lebens nur noch Romane schreiben.
Was reizt dich am Genre Krimi/Thriller?
Die Überraschung. Das «Angst machen». Scheinbar ist das ein Teil meiner DNA, wie bei Katzen das Jagen.
Es gibt die Einteilung zwischen hoher Literatur und Unterhaltungsliteratur (was oft einen abschätzigen Unterton in sich trägt). Was hältst du von dieser Unterteilung und hat sie einen Einfluss auf dich und dein Schreiben?
Ich bin kein Freund der Unterscheidung zwischen U- und E-Literatur. Aber ich kann verstehen, dass es für den Buchhandel einfacher ist. Schließlich wird in der Musik genauso verfahren. Am Ende findet jedes Buch seine Leserschaft.
Dein neustes Buch „Finster“ ist eine Anlehnung an die Dürrenmatt-Verfilmung „Es geschah am helllichten Tag“ (die ich sehr liebe). Was hat dich dazu gebracht, diesen Stoff neu aufzugreifen?
Mich hat der Film als Jugendlicher sehr fasziniert. Besonders Gerd Fröbe als Antagonist. Erst später kam auch die Faszination zu Dürrenmatts weiteren Werken, die ich ebenfalls sehr liebe. Ich wollte das Gefühl, das ich damals beim Filmsehen hatte, in meine eigene Vision des Grauens umsetzen. Es ist meine Art der Verbeugung vor Dürrenmatt.
Dein Buch spielt 1986, eine Zeit, in der auch in der Schweiz immer wieder Kinder verschwanden. Wann und wie kann dir die Idee, deinen Thriller in der Zeit spielen zu lassen?
Da ich 1986 selbst dreizehn Jahre alt war, konnte ich mich gut in die Zeit von Tschernobyl, der Popmusik und dem kalten Krieg einfühlen – aus Kindersicht.
Ein weiteres Thema des Buches ist die Liebe zwischen Stahl und Geli. Liebe im Alter – in unserem Alter meistens noch nicht erste Priorität der Themen. Wieso doch?
Die Liebesgeschichte zwischen Stahl und Geli habe ich bewusst und mit Freude geschrieben, um meiner Leserschaft zu zeigen, dass Liebe nicht irgendwann aufhört. Nur weil man älter ist. Ich habe die beiden sehr in mein Herz geschlossen. Sind sie nicht süß?
Goethe sagte, alles Schreiben sei autobiografisch. Nun ist jeder Mensch ein Kind seiner Zeit und seines Umfelds, wie viel von dir steckt in deinen Romanen, in den einzelnen Figuren?
Es gibt tatsächlich ein Kapitel in diesem Buch, das ich selbst als Kind erlebt habe. Eine schlimme Erfahrung. Es war mir ein Anliegen, sie durch dieses Buch zu verewigen.
Was treibt dich immer wieder an, noch ein Buch zu schreiben? Oder anders gefragt: Wäre ein Leben ohne zu schreiben denkbar für dich?
Ein Leben ohne Geschichten ist für mich nicht denkbar. Ich habe so viele Ideen, und täglich kommen neue dazu, so viele Bücher kann ich gar nicht schreiben.
Was muss ein Buch haben, damit es dich beim Lesen begeistert und wieso? Legst du Wert auf das Thema, die Sprache oder die Geschichte? Ist das beim eigenen Schreiben gleich?
Ich lege Wert auf Geschichten, die mich unterhalten. Die mich miträtseln lassen, so sehr, dass ich den ganzen Tag an das Buch denken muss und mich darauf freue, es endlich weiterzulesen. Es gibt aber auch Bücher, die ich hauptsächlich wegen ihres Stils sehr gerne lese. Dazu gehören die Werke von Martin Suter und Daniela Krien.
Wenn du fünf Bücher nennen müsstest, die in deinem Leben eine Bedeutung haben oder die du anderen empfehlen möchtest, welche wären es?
An allerster Stelle kommt „Das Parfüm“ von Patrick Süskind, von dem ich verschiedene Originalausgaben sammle. Mein großes Vorbild, durch das ich mich jahrelang nicht getraut habe, selbst zu schreiben. Weil ich dachte, so einen wundervollen Stil wirst du niemals entwickeln. Bis mir klar wurde, ich habe eine eigene Stimme. Darüber hinaus empfehle ich alle Bücher von Jason Starr, „Ein perfekter Freund“ von Martin Suter, aber auch „Melody“, „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ von Daniela Krien und Shirley Jackson „Wir haben schon immer im Schloss gelebt“.
Was rätst du einem Menschen, der ernsthaft ein Buch schreiben möchte?
Mein Ratschlag ist der, den ich selbst bei meinem Debütroman angewendet habe: Schreibe jeden Tag eine Seite. Nur eine Seite, das kann man im Alltag gut einrichten. Und in einem Jahr hast du 365 Seiten – einen fertigen Roman.