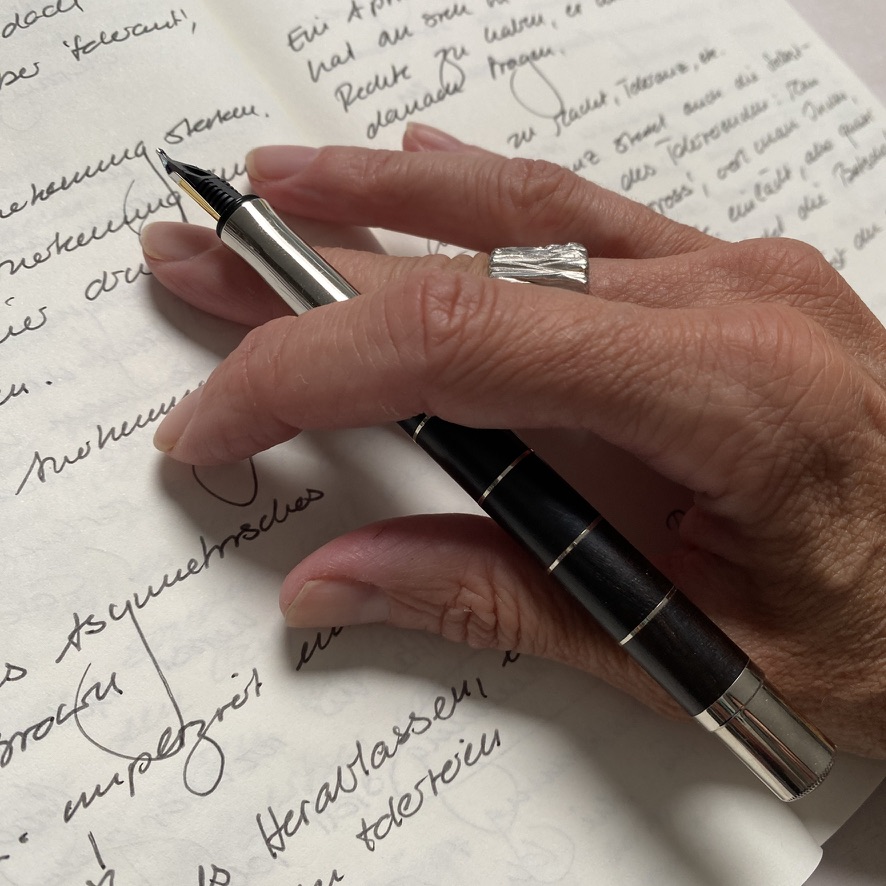Lieber Papa
Erinnerungen sind geschmeidig. Sie lassen sich formen. Manchmal ist auch nicht klar, ob ich etwas wirklich selbst erlebt oder nur gehört habe. Wenn etwas immer wieder erzählt wird, fühlt es sich plötzlich so an, als wäre es erlebt. Dann glaube ich, ins eigene Erinnern zu greifen, wenn ich daran denke, während ich in Tat und Wahrheit nur die Erinnerung von jemand anderem nacherzähle. Auch das ist ein Erinnern, quasi eines der zweiten Ordnung. Ein Erinnern an eine Erinnerung, die selbst auch wieder ein un-fassbares Produkt ist.
An eines erinnere ich mich aber gut: Bei uns gab es immer klare Regeln. Du stelltest sie auf, ich hatte sie zu befolgen. So hattest du alles unter Kontrolle. Vor allem mich.
Wir hatten diesen Spielplatz vor dem Haus. Das Haus lag inmitten anderer Häuser mit eigenen Spielplätzen. Sie alle waren verbunden durch ein Netz von Gehwegen. Keine Autos, keine Gefahren. Wir Kinder zirkulierten zwischen den Spielplätzen, weil auf allen wieder andere Geräte waren und andere Kinder spielten.
So wäre es schön gewesen, aber: Das Wir stimmt nicht. Nur die anderen Kinder zirkulierten, ich durfte nicht weg von dem Spielplatz vor unserem Haus, weil du die anderen nicht sehen konntest von unserem Balkon aus. Wenn also alle anderen weiterzogen, musste ich allein zurückbleiben. Anfangs fragten sie noch, ob ich mitkomme. Sie hörten bald auf damit. Ich gehörte nicht mehr dazu, stand am Rand. «Die kommt eh nie mit.» Sagten sie. Während die anderen immer mehr zusammenwuchsen durch ihre Touren von Platz zu Platz, fiel ich hinaus durch mein Dableiben.
Ich war auch immer die Erste, die heimmusste. «Kinder gehören zu gewissen Zeiten nach Hause.» Sagtest du. «Die anderen haben keine Ordnung.» Dein Ton dabei war eindeutig. Abschätzig. So geht das nicht. Das klang laut mit. Begehrte ich auf, hörte ich, wie undankbar ich sei.
«Ich meine es nur gut.»
Sagtest du.
«Es ist zu deinem Besten.»
Sagtest du. Regeln und Ordnung seien wichtig. Ich glaubte immer, wir seien die einzigen, die diese Regeln und die Ordnung kannten. Ich hätte sie lieber nicht gekannt. Aber das durfte ich nicht sagen. Wie ich nur so sein könne. Fragtest du dann und blicktest mich mit diesen traurigen und enttäuschten Augen an. Und schwiegst. Drehtest dich um und liefst weg. Von mir. Ich war allein.
«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.»
Der Spruch wird Lenin zugeschrieben. Ich frage mich manchmal, woher dein Kontrollbedürfnis kam. War es ausschliesslich die Sorge um mich? Oder vielleicht mehr eine Angst von dir? Kürzlich las ich sinngemäss:
«So lange ich die Kontrolle über mein Leben habe, habe ich keine Angst, den Halt zu verlieren.»
Ich weiss nicht mehr, wer es sagte, aber ich kann den Gedanken verstehen. Die Angst, dass alles aus den Fugen gerät, kein Stein auf dem anderen bleibt. Die Angst, etwas zu verlieren, das wichtig ist. Die Angst vor dem Unvorhergesehenen, dem Drohenden, das passieren könnte. War dir die Kontrolle darum so wichtig? War sie dein Versuch, mit den Gefahren des Lebens umzugehen? Konntest du so deine Angst vor einem Unglück im Zaum halten? Weil du schon einmal alles verloren hattest – deinen Lebensmut inklusive? Das erfuhr ich allerdings erst viel später, als Kind wusste ich nichts davon. Ich konnte das alles nicht einordnen. Ich machte mir auch keine solchen Gedanken. Ich kannte nur die Regeln und wusste, dass es nicht gut kommt, wenn ich sie nicht befolge. Ich stellte sie ab und zu noch in Frage, aber es gab kein Entkommen. Du warst unnachgiebig.
Ich fand all das oft unfair. Sah all die Freiheiten der anderen und meine engen Grenzen. Spürte all die Gebote und Verbote und dass sie mich von den anderen trennten. Ich habe dir nie eine böse Absicht unterstellt. Glaube ich. Ich tue es vor allem heute nicht. Aber es machte mich traurig. Macht es noch heute, merke ich, während ich das schreibe. Denn ich war ausgeschlossen dadurch. Und allein. Nur dich, dich hatte ich noch, wenn ich die Regeln befolgte. So warst du alles.
(«Alles aus Liebe», XVI)