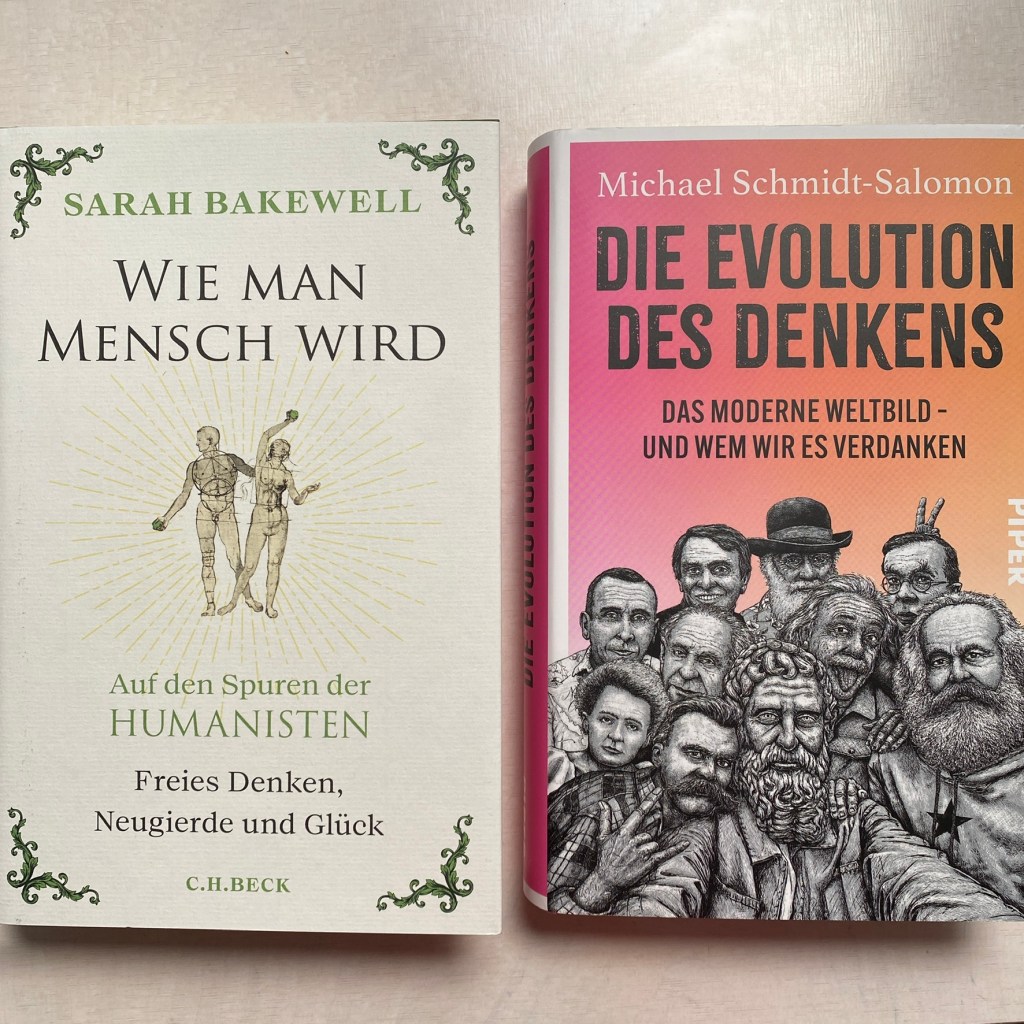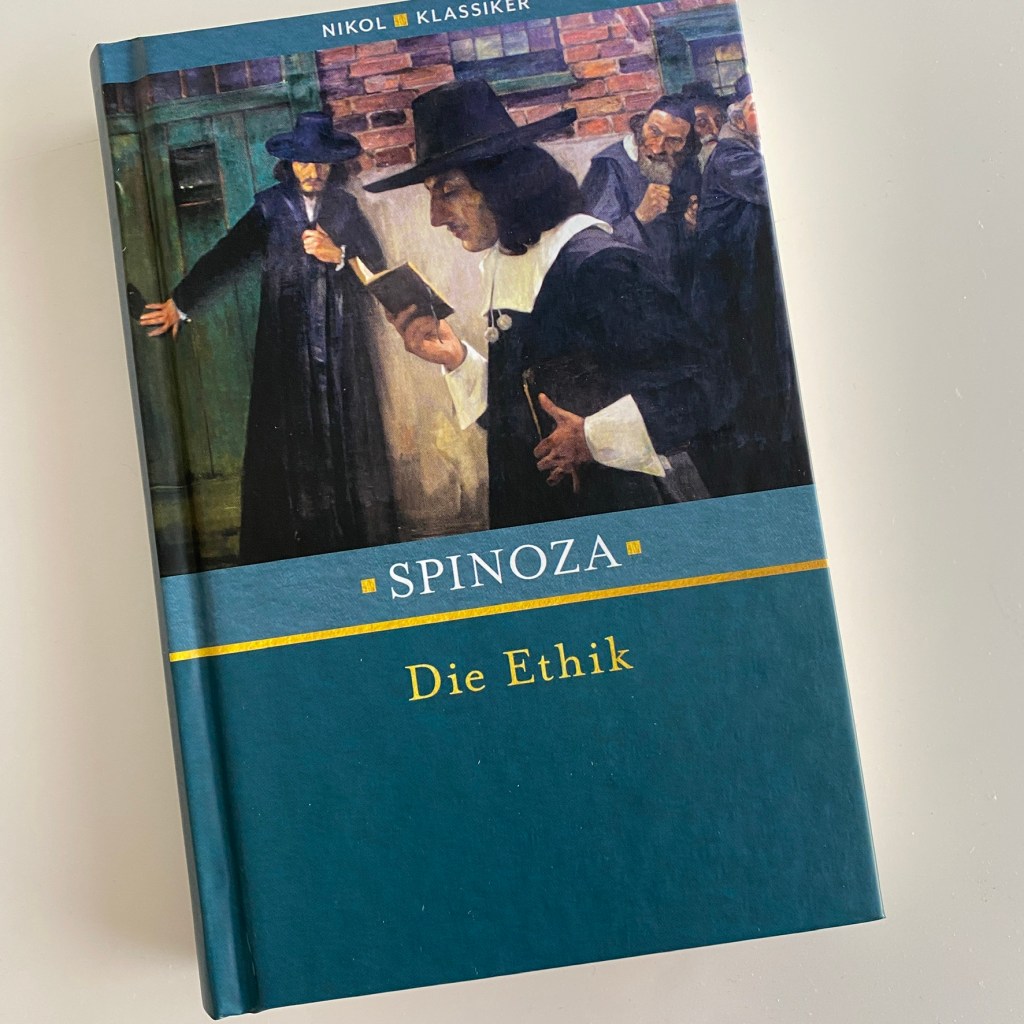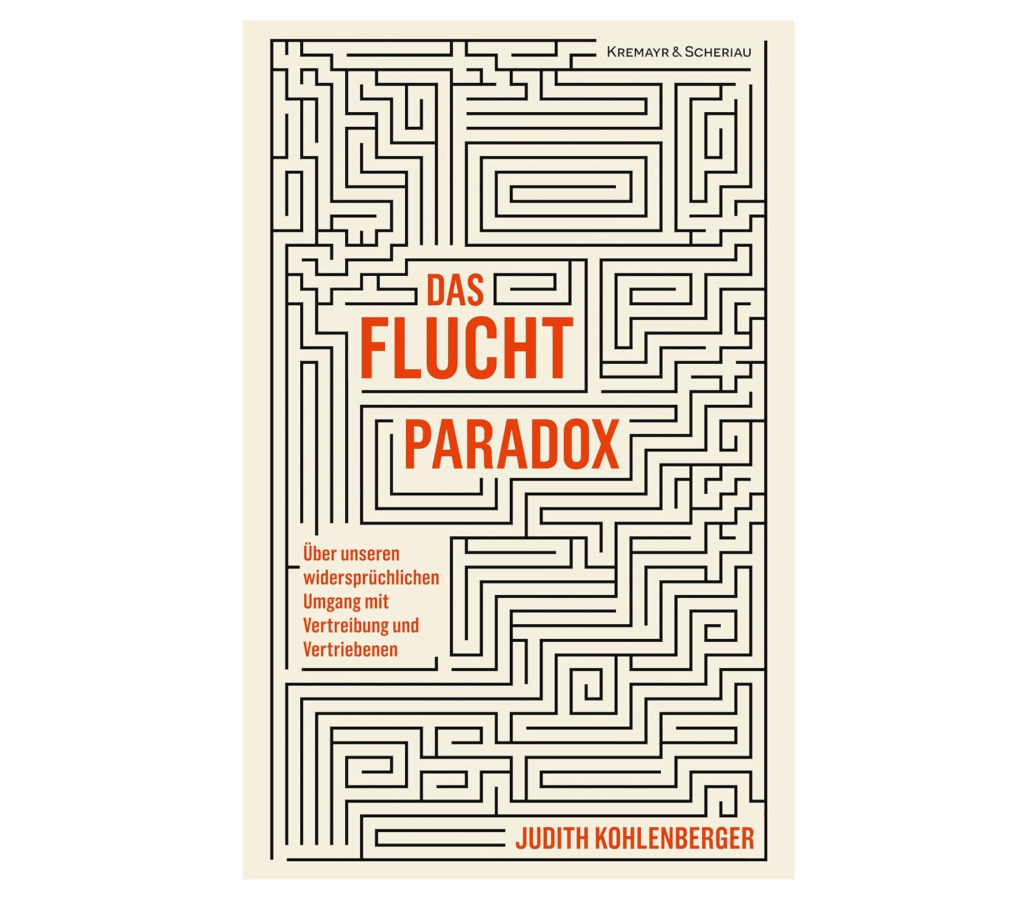Beim Gang durch die Welt schnappe ich immer wieder Dinge auf, die mich inspirieren, die mich bewegen, die mich begeistern. Diese möchte ich mit uns teilen. Vielleicht findet ihr etwas für euch dabei.
Folgende Bücher kann ich ans Herz legen, sie haben mich begeistert beim Lesen:
Michael Schmidt-Salomon: Die Evolution des Denkens
«Tatsächlich hat ‘das Genie’ mit der realen Person, die im Zentrum des Verehrungskults steht, oft wenig gemein… Hinter dem Kult verbirgt sich jedoch ein tiefes menschliches Bedürfnis: Wir brauchen Vorbilder, um uns in unserem Leben zu orientieren. Sie sind Teil unserer Identität, sagen uns, wer wir sind oder sein könnten.»
10 grosse Denker, ihr Leben und Schaffen im Blick, um daraus Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen. Michael Schmidt-Salomon zeigt, dass all die klugen Geister ihr mutiges und neugieriges Denken und Forschen, ihre Unabhängigkeit, ihr Sinn für Vernetzung und ihr offener Blick sowie der Umstand, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, zu den Denkriesen machte, als die wir sie heute sehen. Was können sie uns also zeigen, was uns für unsere Zeit nützt? Ein sehr informatives, kurzweiliges, packendes Buch.
(Michael Schmidt-Salomon: Die Evolution des Denkens: Das moderne Weltbild – und wem wir es verdanken, Piper Verlag 2024)
Sarah Bakewell: Wie man Mensch wird
«Ich bin ein Mensch, und nichts Menschliches erachte ich als mir fremd.» Publius Terentius Afer
Sarah Bakewell rollt die Geschichte des Humanismus von Anfang an auf. Was heisst es, humanistisch zu denken und zu handeln? Worauf gründen Entscheidungen, was macht den Menschen aus? Ausgehend von der Idee, dass der Mensch im Kern gut sei, bildete sich vor über 700 Jahren eine Lebenshaltung aus, deren Ziel es ist, den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zum Menschen zu machen, der er ist: ein freies, glückliches, im Hier und Jetzt lebendes Wesen, dem das friedliche Miteinander am Herzen liegt, weswegen er auf Mitgefühl und Verantwortung setzt statt auf Gebote und Gesetze. Bakewell erzählt aus dem Leben verschiedener Literaten, Künstler, Denker und zeigt ihre Lebens- und Denkwege auf. Für mich etwas viel Geschichte und zu wenig Denken, was aber subjektiven Vorlieben geschuldet ist.
(Sarah Bakewell: Wie man Mensch wird: Auf den Spuren der Humanisten, C. H. Beck Verlag 2023)
Arthur Schnitzler: Die Traumnovelle
«So gewiss, als ich ahne, dass die Wirklichkeit einer Nacht, dass nicht einmal die eines ganzen Menschenlebens zugleich auch seine innerste Wahrheit bedeutet.»
«Und kein Traum», seufzte er leise, «ist völlig Traum.»
Die Geschichte von Fridolin und Albertine, einem jungen Ehepaar mit einer kleinen Tochter, verbunden in einer innigen Beziehung, die Risse bekommt, als sie beschliessen, sich alles zu sagen. Die jeweiligen erotischen und Fantasien und Hoffnungen verwirren nicht nur jeden für sich, sondern führen auch zu emotionalen Abgründen miteinander. Was für eine Sprache, was für eine Welt, in die man da hineingerät: In die Tiefen des menschlichen Fühlens und Wünschen. Wo liegt die Wahrheit? Was ist wirklich gewollt, gelebt, was nur geträumt?
(Arthur Schnitzler: Traumnovelle – in verschiedenen Ausgaben, unter anderem SZ Bibliothek 2004)
Folgenden Podcast habe ich gehört:
Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinić und Ilker Çatak
«Freiheit kommt mit Bewusstsein.» David Foster-Wallace (abgekürzt)
Ein Gespräch über Freiheit, über Ausgrenzung, darüber, ignoriert und ausgeschlossen zu werden. Es ist ein Gespräch über die blinden Flecken in der Gesellschaft, in welcher Exklusion schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es nicht mehr auffällt – ausser, man ist betroffen. Es ist ein Gespräch darüber, wie wir mit mehr Bewusstsein unser Leben leben sollen, denn nur so sind wir frei. Und vieles mehr.
Das vollständige Zitat lautet:
„Die wirklich wichtige Art der Freiheit beinhaltet Aufmerksamkeit und Bewusstsein, Disziplin und Anstrengung, und die Fähigkeit, sich wirklich um andere Menschen zu sorgen, für Sie Opfer zu bringen, jeden Tag auf neue auf unzählige, kleine, unsittliche Arten und Weisen.“
Überhaupt möchte ich euch den Podcast von Jagoda Marinić ans Herz legen. Sie hat eine sehr warme, kompetente Art zu fragen und zuzuhören. Es sind Gespräche, die in die Tiefe gehen, die Persönliches ans Licht bringen und auch die Gesellschaft, wie sie ist, und unser Sein darin immer wieder hinterfragen.
In der ARD-Mediathek und bei SRF Play findet sich nun der von Daniel Kehlmann geschriebene Sechsteiler über Franz Kafka. Da kommt alles zur Sprache: Das Verhältnis zum Vater, die Beziehungen zu den verschiedenen Frauen, seine Freundschaft zu Max Brod – und vieles mehr. Ich bin sehr gespannt, ich habe die Serie noch nicht gesehen.
Zu Kafka werde ich in den nächsten Wochen sicher noch mehr schreiben.
Ich hoffe, ihr habt etwas gefunden, das euch anspricht. Wenn ihr Tipps für mich habt, immer nur her damit.
Habt eine gute Woche!