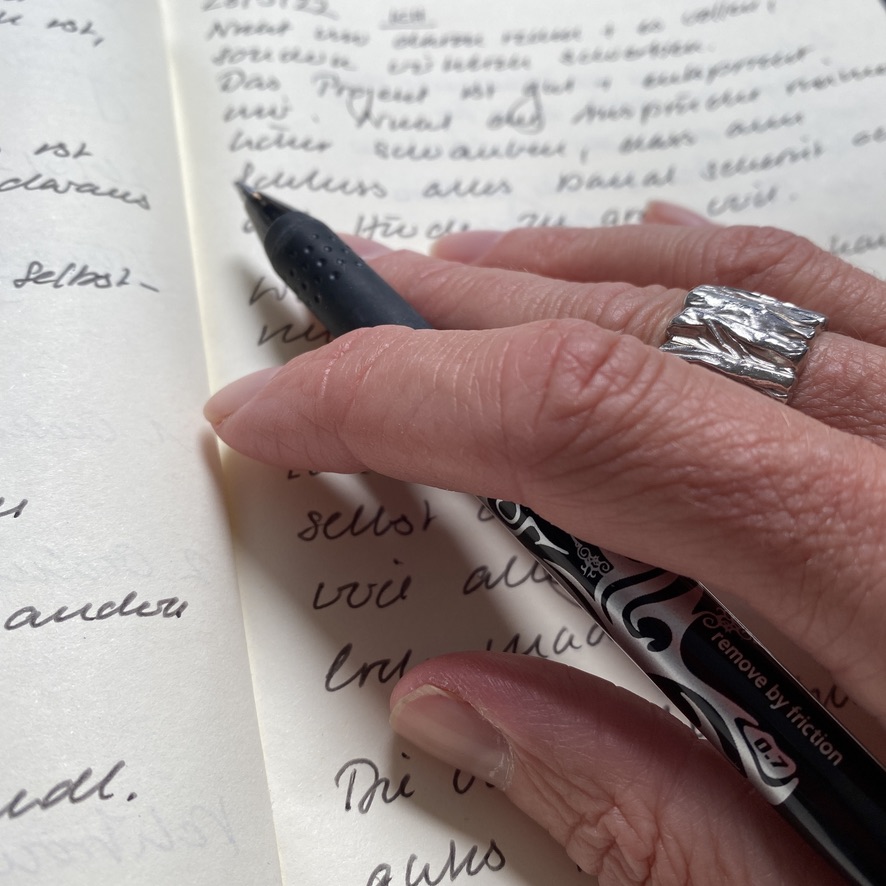Lieber Papa
Wenn ich in Spanien bin, sehe ich sie oft: Die Familien, die am Wochenende oder an Feiertagen an den Strand fahren und dort ein zweites Wohnzimmer aufbauen. Alle helfen mit. Sie haben an alles gedacht: ein Zelt, Sonnenschirme, Tische, Stühle, Liegen, Kühltruhen und Essen. Berge von Essen. Ganze Buffets werden aufgestellt. Alle reden und lachen laut durcheinander, sie feiern das Leben.
Erinnerst du dich? Wir gingen früher auch manchmal zum Picknick. Meist in den Wald. Nur wir drei. Ohne Lachen und ohne Zelt, aber mit Klappstühlen, einer Kühlbox, Getränken, gekochten Eiern, Würsten, Brot, einer Decke, Gläsern, Teller, Besteck. Alles hatte seine Ordnung.
Wir luden alles ins Auto, fuhren zum nahegelegenen Wald, parkten auf dem Parkplatz und schleppten alles zur Feuerstelle im Innern des Waldes. Grössere Scheite lagen schon vor Ort bereit, die kleineren, feineren zum Anfeuern gingst du sammeln. Ein Picknick, wie es im Schulbuch steht.
Während ich das so schreibe, merke ich, wie in mir Unmut hochkommt. Es wirkt alles so leblos, so freudlos, so einstudiert und durchorganisiert. Wo ist das Freudige, das Bunte, Improvisierte? Und gleichzeitig schelte ich mich für diese Gefühle und Gedanken. Ist es nicht gut, wenn man Dinge so plant, dass sie klappen? Ich frage mich zudem, ob ich nicht zu viel hineinlege in diese Erinnerung. Will ich es düster sehen? Habe ich ein Bild, in das ich die Geschichte einpassen will? Und ich gehe weiter, frage mich, ob das überhaupt Erinnerungen sind. Ich erinnere mich an einen Ausspruch von Max Frisch, wonach wir uns Geschichten erzählen und sie dann für unser Leben halten. In Ivrin D. Yaloms Memoiren las ich etwas ähnliches. Er schrieb, dass er die Realität für eine wandelbare Sache halte, dass Erinnerungen dadurch oft fiktiver seien als man glaube. So fühlt sich das an. Woher also kommt diese Geschichte in mir? Ich weiss es nicht, aber ich möchte sie weitererzählen:
Das Anfeuern dauerte oft lang, eine Geduldprobe. Wenn das Feuer so richtig schön brannte, hatte das Warten noch kein Ende, dann mussten die Flammen sich erst wieder legen. Erst dann konnten wir die Würste braten. Ich sage heute oft, das G in meinem Namen stehe für Geduld – sie fehlte mir schon damals. Dieses stille Warten war nichts für mich.
Aus der Langeweile heraus entstehen die schönsten Ideen, so packte ich meinen Klappstuhl und lief damit zum Waldrand. Ich setzte mich hin und wartete auf Spaziergänger, die vorbeikamen. Sie schienen sich zu freuen, auf alle Fälle erwiderten sie alle meinen Gruss und plauderten mit mir. Ich genoss es – leider nicht lange. Plötzlich standst du hinter mir, offensichtlich wütend. Was mir eigentlich einfalle, die Leute zu belästigen, fragtest du. Ich sagte, die hätten sich gefreut. Irrtum, meintest du, die seien nur höflich gewesen. Wie hatte ich mich nur so täuschen können. So dachte ich. Es tat ein wenig weh.
Ich musste auf der Stelle zurück an die Feuerstelle, und eines war klar: Ich hatte die strenge Ordnung des Picknicks gestört. Ich war mal wieder nicht in Ordnung gewesen. Der Rest des Picknicks verlief schweigend.
Erinnerst du dich? Das war immer deine Taktik. Durch Schweigen zeigtest du mir, dass ich vom richtigen Weg abgekommen bin. Dein Schweigen nahm den ganzen Raum ein, liess mich deine Enttäuschung über mich spüren. Manchmal dauerte es lange. Zwei Wochen ohne ein Wort von dir. Dein Blick glitt an mir vorüber, du nahmst mich nicht mehr wahr.
Interessant, dass dieses Schweigen für mich die Höchststrafe bedeutete, waren wir doch auch sonst keine sehr beredte Familie. Aber so war das. Wenn die wenigen Worte zur Totenstille anwuchsen, dann fühlte es sich an, als sei damit alles gestorben: deine Liebe zu mir, ich für dich – und damit auch ich für mich.
Ich weiss nicht mehr, wie es nach dem Schweigen jeweils zum ersten Wort kam. Was löste es aus? Wie fühlte es sich an? Ich stelle mir vor, es war wie der erste Schluck Wasser für einen, der fast verdurstete. Aber das ist reine Fantasie, ich erinnere mich nicht.
(„Alles aus Liebe“, VIII)