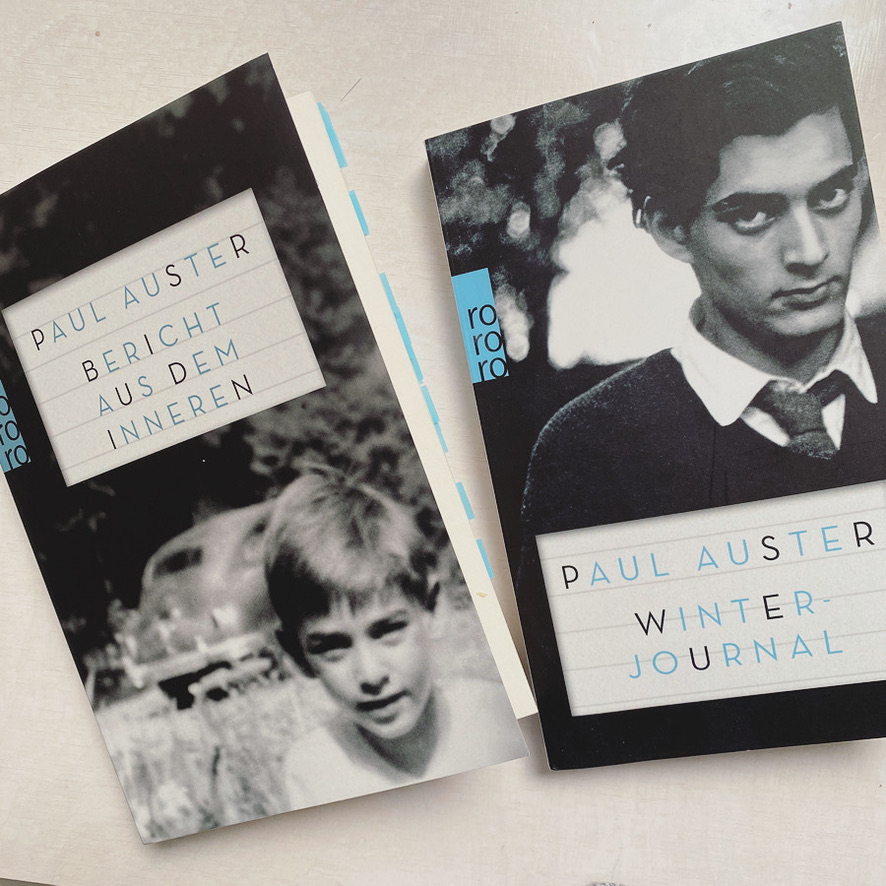«Ständig bewohnt von Gefühlen
Gespinst voll von Gespinsten
wehenden,
flatternden, zerrissenen
veränderlichen, denen ich ein
mangelhaftes Haus aus Fleisch und Wasser und Muskel
und Haut gebaut hab.»
Heute vor 51 Jahren starb Ingeborg Bachmann. Ich hebe mein Glas auf diese wunderbare, tiefgründige Frau und Schriftstellerin, die so viele verschiedene Facetten in sich trug, dass wohl nie alle ans Licht kommen werden. Das macht sie einerseits zum Mysterium, andererseits aber zutiefst menschlich, sind wir doch alle mit unterschiedlichen Sehnsüchten, Anlagen und Facetten bestückt.
Selbst gab sie kaum Informationen über sich preis, und wenn, dann widersprachen sich die einzelnen in einer Weise, dass man nie sicher sein konnte, was denn nun stimmte. Diese Mehrdeutigkeit war nicht nur in ihren Selbstaussagen zu finden, auch ihr Verhalten sprach eine ähnliche Sprache. Mal ungeschickt, schüchtern flüsternd, dann wieder ganz Ikone und Grand Dame der Deutschen Lyrik. Dass vieles davon nur Selbstinszenierung war, liegt auf der Hand, gedacht als Schutzschild, was auf eine unsichere Person hinter diesem deuten lässt. Liest man die Lebensgeschichte, lässt sich dieses Bild leicht bestätigen. Und doch wusste Bachmann schon früh, was sie will im Leben: Schreiben.
In diesem kommt man Ingeborg Bachmann wohl auch am nächsten. Dabei finden sich darin keine chronologischen Lebenserzählungen, sondern eher Bilder von Gefühlswelten. Oft schreibt sie von Frauen als verwundetes Wesen, von grausamen Männern, von nicht gelebter Liebe, von Tod, Angst, Mord, Unsicherheiten? Wäre es bloss eine Geschichte mit diesen Themen, könnte man an schöpferische Freiheit und phantasievolle Vorstellung glauben, doch in der Dichte? Glaubt man Goethes Aussage, dass alles Schreiben autobiographisch ist, so muss man zum Schluss kommen, dass ganz viel Ingeborg im Bachmannschen Werk steckt
«Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte
ist alltäglich geworden. Der Held
bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache
Ist in die Feuerzone gerückt.
Die Uniform des Tages ist die Geduld,
die Auszeichnung der armselige Stern
der Hoffnung über dem Herzen.»
Ingeborg Bachmann fühlte sich lange, wenn nicht zeitlebens schuldig für ihre Herkunft als Tätertochter. Sie hat es als Pflicht gesehen, ihren Teil dazu beizutragen, dass nicht einfach weiter geht, was so viel Unheil angerichtet hat. Dies tat sie unter anderen mit ihren Gedichten, später auch in der Prosa, indem sie die Geschichte und die durch diese aufgeladene Schuld immer wieder thematisierte, den (eigentlichen Nicht-) Umgang damit durch ihre Beschreibung der Kritik zugänglich machte.
Hinschauen wollte sie, nicht schweigen – zumindest im öffentlichen Raum, denn über das Private, vor allem die Vergangenheit ihres Vaters, schwieg auch sie.
«Allein sein. Frei sein.»
Sucht man einen einzigen Ausdruck, der Ingeborg Bachmann beschreiben soll, so könnte man sie wohl eine «unglücklich Liebende» nennen. Zeitlebens auf der Suche nach Liebe, wollte sich doch keine wirklich lebbare einstellen. Das mag teilweise an den Männern gelegen haben, hatte aber sicher auch einen grossen Anteil bei Bachmann selber. Sie konnte und wollte sich nicht anpassen, unterordnen, abhängig sein, sie kämpfte für ihre Freiheit, ihre Autonomie. Und: Sie stellte ihr Schreiben über alles. Sie war nicht bereit, dafür Zugeständnisse zu machen. So scheiterte ihre grosse Liebe zu Paul Celan, die Beziehung mit Max Frisch, und auch jede Liebelei zwischendurch. Zurück blieb eine einsame Frau, die am Leben und der fehlenden Liebe krankte. Und irgendwann blieben auch die Worte aus, um die sie sowieso zeitlebens kämpfte, da sie ihr selten einfach zuflogen.
„Meine Gedichte sind mir abhanden gekommen.
Ich suche sie in allen Zimmerwinkeln.
Weiss vor Schmerz nicht, wie man einen Schmerz
aufschreibt, weiss überhaupt nichts mehr.
Weiss, dass man so nicht daherreden kann,
es muss würziger sein, eine gepfefferte Metapher.
müsste einem einfallen. Aber mit dem Messer im Rücken.
Parlo e tacio, flüchte ich mich in ein Idion,
in dem sogar Spanisches vorkommt, los toros y
las planetas, auf einer alten gestohlenen Platte
vielleicht noch zu hören. Mit ezwas Französischem
geht es auch, tu es mon amour depuis si longtemps.
Adieu, ihr schönen Worte, mit euren Verheissungen.
Warum habt ihr mich verlassen. War euch nicht wohl?
Ich habe euch hinterlegt bei einem Herzen, aus Stein.
Tut dort für mich, Haltet dort aus, tut dort für mich ein Werk.“
Mit nur 47 Jahren ist Ingeborg Bachmann gestorben. Ihr Tod war genauso mysteriös wie ihr Leben. Ein Kreis schloss sic
„Wir halten. Beenden den Trott.
Sonst ist auch das Ende verdorben.
Und richten die Augen auf Gott:
wir haben den Abschied erworben!“