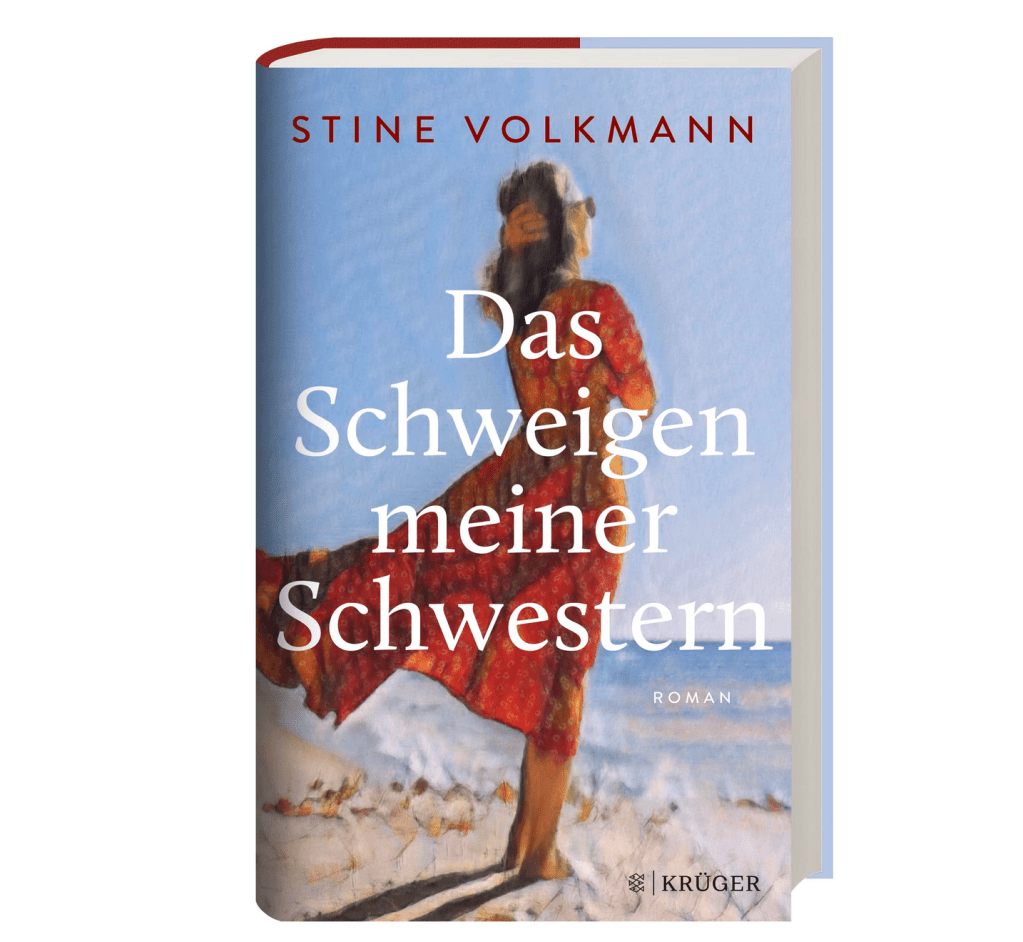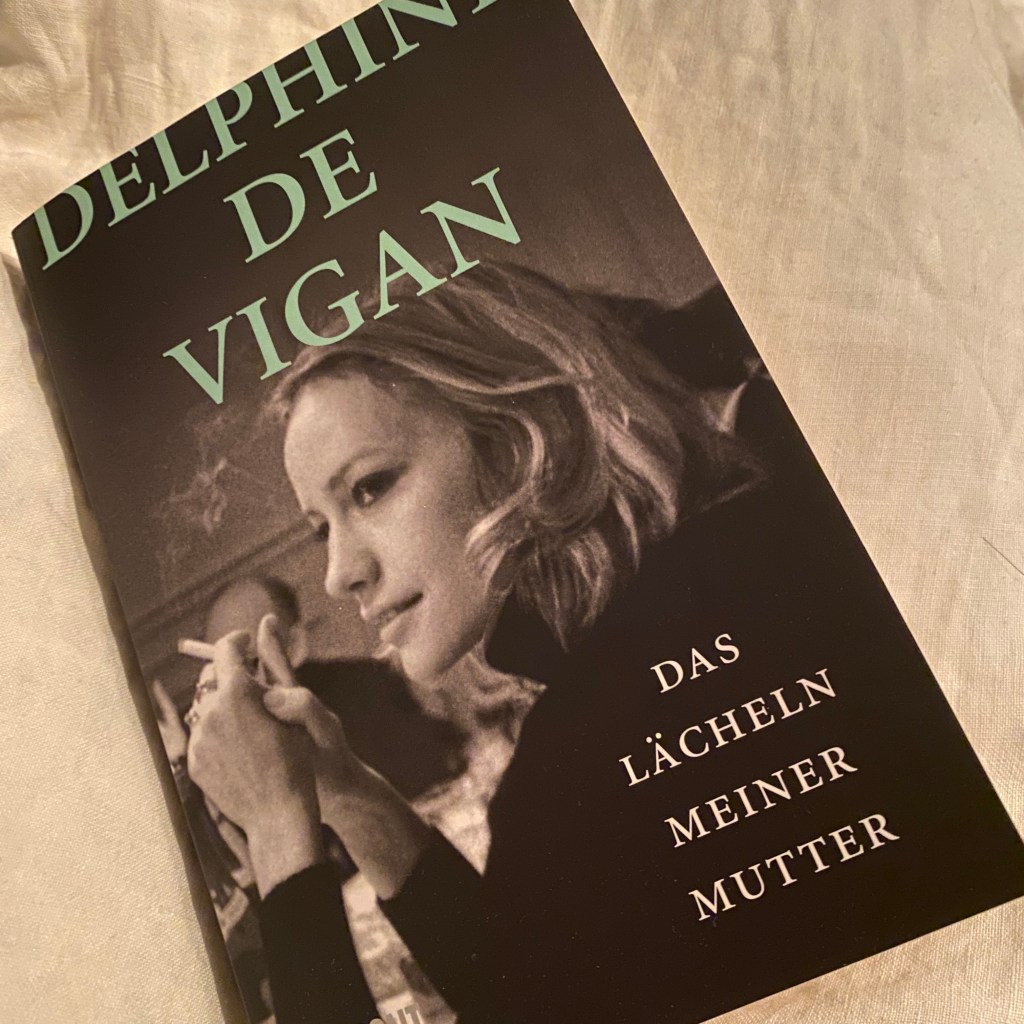Inhalt
„Ich schäme mich, weil ich Mutter angerufen hatte. Es war gegen die Regeln, aber ich hatte es trotzdem getan. Ich hatte gegen ein Verbot, das ich mir selbst auferlegt hatte, und gegen ein Verbot, das mir auferlegt worden war, verstossen.“
Die Künstlerin Johanna verlässt den frischgebackenen, angemessen Ehemann und die gutbürgerliche Familie, um in Amerika mit ihrer grossen Liebe, einem Künstler, ein neues Leben aufzubauen. Nach 30 Jahren ohne Kontakt zu ihrer Familie kehrt sie wegen einer Ausstellung ihrer Bilder in ihre Heimat zurück und möchte die Vergangenheit mit ihrer Mutter aufarbeiten. Sie ruft an, doch Mutter drückt sie weg. Sie verweigert den Kontakt. Ein Versteckspiel beginnt.
Ein Roman aus der Tiefe des Ichs einer verletzten Tochter, die von vielen offenen Fragen geplagt wird und nach Antworten sucht. Eine Erzählung aus der Sicht einer Tochter, die sich in inneren Monologen klarzuwerden versucht, wer diese Mutter wirklich war und heute noch ist. Ein Roman ums Mutter- und Tochtersein, um Schuld und Verpflichtung, um Familie und Eigenständigkeit. Packend, einnehmend, grossartig.
Gedanken zum Buch
«Ich fahre schweissnass aus dem Schlaf hoch und begreife, dass unsere frühere Beziehung in mir überlebt hat, dass die Abhängigkeit, in der ich einmal zu ihr stand und die ich gleichzeitig geliebt und verabscheut habe, in mir lebt.»
Beziehungen, gerade solche, die schwierig waren, würden wir oft gerne hinter uns lassen. Wir möchten das Schwere vergessen, die Vergangenheit abhaken, nach vorne schauen, unbeschwert. Meist ist das nicht so leicht, schon gar nicht, wenn es sich bei der Beziehung um die zur eigenen Mutter handelt. Sie hängt einem nach, meist ein Leben lang, egal, ob man real Kontakt zu ihr hat oder nicht, egal, ob man die Beziehung als störend, verstörend gar, vielleicht auch verletzend empfand. Sie ist und wird es immer bleiben: Die Mutter. Schon in dem Wort stecken Bilder, Hoffnungen, (erfüllte und noch mehr unerfüllte) Sehnsüchte – und mit allem muss man sich irgendwie zurechtfinden.
«Mutter hat sich längst mit dem Tochterverlust abgefunden. Sie will das Beste aus ihrem Leben machen. Warum finde ich mich nicht mit dem Mutterverlust ab? Ich finde mich mit dem Mutterverlust ab, aber ich finde mich nicht damit ab, dass Mutter sich mit dem Tochterverlust abgefunden hat?»
Ist es für eine Mutter möglich, zu sagen, sie habe kein Kind mehr? Kann eine Mutter ihr Kind einfach vergessen, ihr Leben weiterführen, als hätte es dieses Kind nie gegeben? Wie geht man als Kind mit einem solchen Gedanken um? Wie fühlt es sich als Kind an, von der eigenen Mutter vergessen worden zu sein, der Mutter, die man im Gegenzug nicht aus den eigenen Gedanken bringt, egal, wie sehr man es möchte? Wünscht man sich, dass sie sich genauso quält wie man selbst? Weil man denkt, so wenigstens einen Stellenwert bei ihr zu haben, wie sie ihn bei einem selbst hat? Oder ist es eine Form der Rache? Sie soll keine Ruhe haben, weil sie mir keine lässt?
«Sie kann es nicht geschafft haben, mich so in sich zu töten, dass sie nicht mehr wissen will, wie es mir geht. Aber ich weiss, dass sie nicht ans Telefon kommen wird, ich habe es ja probiert, und trotzdem rufe ich an.»
Es ist kaum zu glauben, dass es einer Mutter gelingen sollte, das eigene Kind in sich abzutöten, indem sie es so weit verdrängt hat, dass es de facto nicht mehr existiert. Der Gedanke, von dem Menschen vergessen worden zu sein, dem die bedingungslose Liebe in die Rolle geschrieben ist, schmerzt. Die Verzweiflung, die aus dieser Verleugnung, dieser Verdrängung wächst, hat etwas Monumentales, denn sie ist nicht vorgesehen in unserem Bild vom Leben, vom Muttersein, vom Kindsein.
«…ich bin die verlorene Tochter, die heimgekehrt ist, aber niemand nimmt sie in Empfang, das ist meine Schuld.»
Die biblische Geschichte vom heimgekehrten Sohn hält dieses Bild aufrecht. Der Sohn, der ging, der alles hinter sich liess. Als er wiederkommt, wird er mit einem Fest und mit Freude empfangen. Was, wenn dieses Bild falsch ist? Wenn dieses Bild nicht auf einen selbst und die Mutterbeziehung passt? Was, wenn man die Tochter ist, die nicht mehr heimkehren kann, weil die Tür zubleibt? Wie viel gerät da ins Wanken?
«Mutter, ich erdichte dich mit Wörtern, um ein Bild von dir zu haben.»
Das Buch «Wahrheiten meiner Mutter» stellt die Mutter-Tochter-Beziehung in Frage. Es wirft Fragen auf und zeigt die innere Auseinandersetzung einer Tochter mit ihrer Mutter, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, ihn aber wieder aufnehmen möchte. Die Vergangenheit hat offene Fragen zurückgelassen, doch die Antworten bleiben aus, weil die einzige Person, die sie geben könnte, sich verweigert. Die Mutter schweigt. Der Tochter bleibt nur, sich ihr eigenes Bild der Mutter zu zeichnen. Ob sie dabei die Wirklichkeit trifft oder nicht, bleibt offen.
Persönliches Fazit
Das Buch hat mich von der ersten Seite an gepackt und nicht mehr losgelassen. Es regte mich zum Nachdenken, zum Nachfühlen an, als ich zum Ende kam, wollte ich einerseits wissen, wie alles aufgelöst wird – glaubend, dass es kein wirkliches Ende geben konnte –, aber ich wollte es auch herauszögern, weil ich nicht aus dieser Welt auftauchen wollte, in der ich mich so tief drin fühlte. Grossartig!