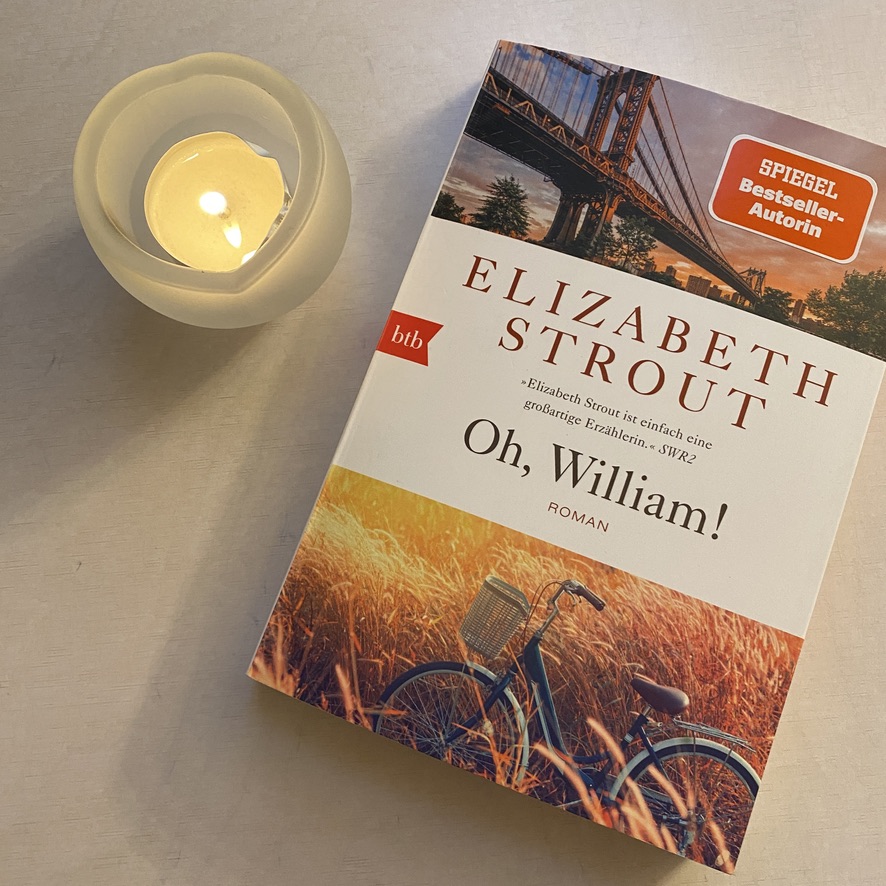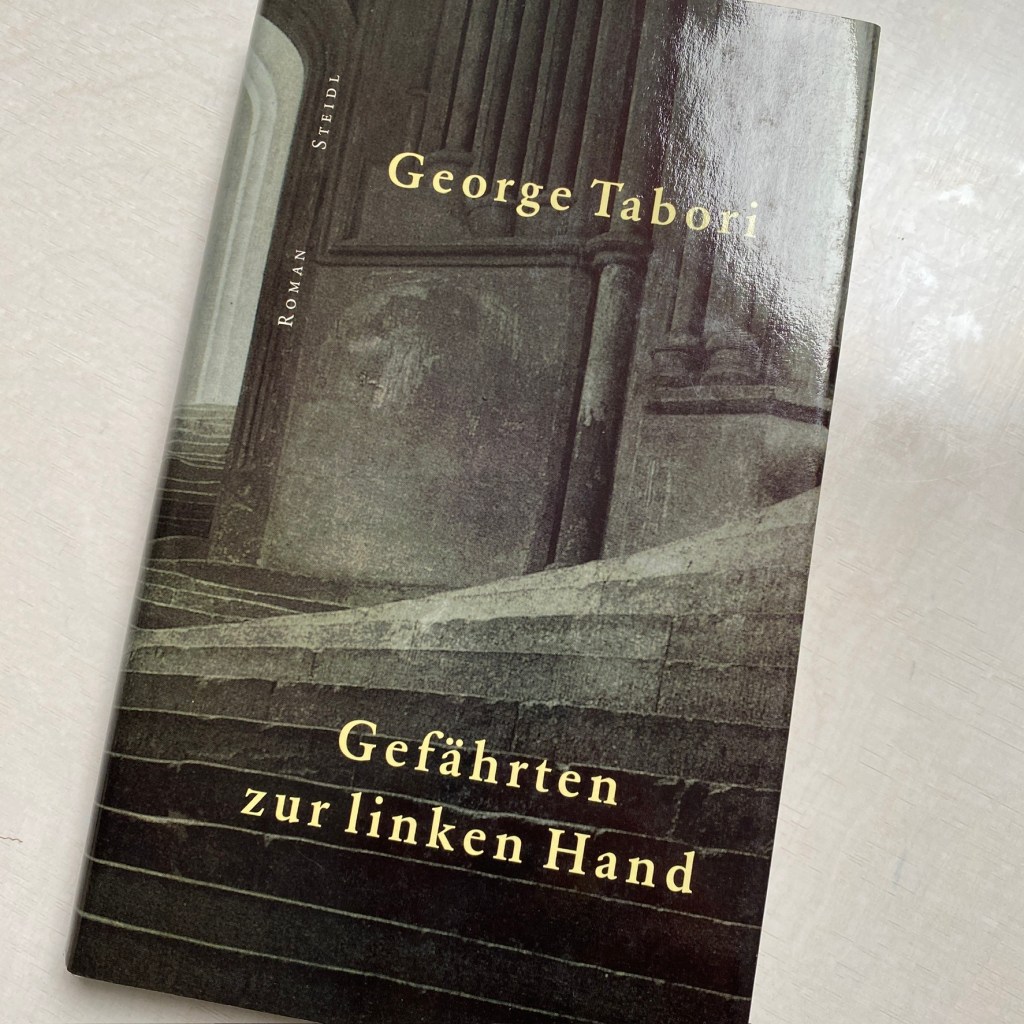Vom Schreiben und vom Leben
«Denn Erzählen, ob mündlich oder schriftlich, holt uns vielmehr erst in die Welt. Es macht uns greifbar und gibt uns die Möglichkeit, das Erlebte zu teilen.»
Nicht nur der Untertitel erinnert an Stephen Kings Buch «Das Leben und das Schreiben», das ganze Buch tut es. Trotzdem ist es nicht einfach eine Kopie. Benedict Wells schreibt offen wie nie über sein Aufwachsen, über seinen Weg hin zum Schriftsteller, der er heute ist. Er schreibt von seinen Plänen, von der Umsetzung, schreibt davon, wie ein Roman entsteht bei ihm und woran er anfangs scheiterte. Ein ehrliches, ein tiefgründiges, ein persönliches Buch.
«Ich habe Geschichten erfunden, weil ich meine eigene lange nicht erzählen konnte.»
Wenn die eigene Geschichte keine leichte ist, fällt es oft schwer, genauer hinzuschauen. Es braucht eine Distanz, die den Schmerz mildert, der zu befürchten ist, wenn man noch in das Vergangene hineinsticht. Und das muss man, will man davon erzählen. Benedict Wells hat Zeit gebraucht, seine eigene Geschichte zu erzählen. Er hat sie hinter sich gelassen und doch immer wieder an ihr entlang geschrieben, indem die Themen seiner Bücher immer um die Themen kreisten, die auch ihn über all die Jahre seines Aufwachsens geprägt haben.
«Wenn ich keine Worte für meine tieferen Gefühle habe, empfinde ich sie überhaupt? Weiss ich dann wirklich, wer ich bin, oder bleibe ich mir am Ende ein Schatten?»
Dass das so ist, hat er nicht selbst gemerkt. Erst als ihn Leser und Freunde darauf hinwiesen, dass in allen seinen Büchern die Einsamkeit ein zentrales Thema war, fiel es auch ihm auf. Irgendwann beschloss er, nun eine Weile keinen Roman mehr zu schreiben. Das war der Moment, an dem er sich für seine eigene Geschichte öffnete. Die Zeit war wohl reif dafür. Entstanden ist dieses wunderbare Buch, in welchem er einen wirklich offenen Blick gewährt auf seine Kindheit, auf sein Aufwachsen, auf seine Hintergründe, die ihn zu dem Schriftsteller werden liessen, der er ist.
«Ich habe Schreiben gelernt, um Gefühlen nicht mehr ausgeliefert zu sein, sondern sie ins Bewusstsein zu holen und mit Menschen zu teilen, die mir wichtig sind.»
Neben dem Blick auf sein Leben gewährt er auch einen auf sein Schaffen. Er schreibt über seinen Prozess von der Idee hin zum fertigen Buch, schreibt von seinen Schwierigkeiten, Niederlagen, von seinem Scheitern und auch vom Erfolg. Entstanden ist ein wunderbar tiefes, ehrliches und authentisches Buch.
«Und so haben wir alle unsere charakterlichen Defizite und Stärken, die sich auf unseren Arbeitsprozess auswirken. Es bringt nichts, sich zu vergleichen und von Hand zu schreiben, nur weil die Lieblingsautorin das macht.»
Wer hofft, mit diesem Buch nun den ultimativen Ratgeber für das Schreiben eines eigenen Buches zu haben, den wird das Buch enttäuschen. Zwar legt es den Schreibprozess von Wells offen, zeigt seinen Werkzeugkasten, zeigt, wie er arbeitet und was auf dem Weg vom ersten Gedanken hin zum fertigen Buch alles zum Einsatz kommt, doch ist es eben genau das: Der Schreibprozess von Benedict Wells. Es gibt wohl so viele Möglichkeiten, ein Buch zu schreiben, wie es Schriftsteller gibt. Jeder muss für sich herausfinden, was am besten passt.
«Es gibt keine todsicheren Tipps für das Schreiben, nur Übung und das Sammeln von Erfahrung.»
(Benedict Wells: Die Geschichten in uns. Vom Leben und vom Schreiben, Diogenes Verlag 2024.)