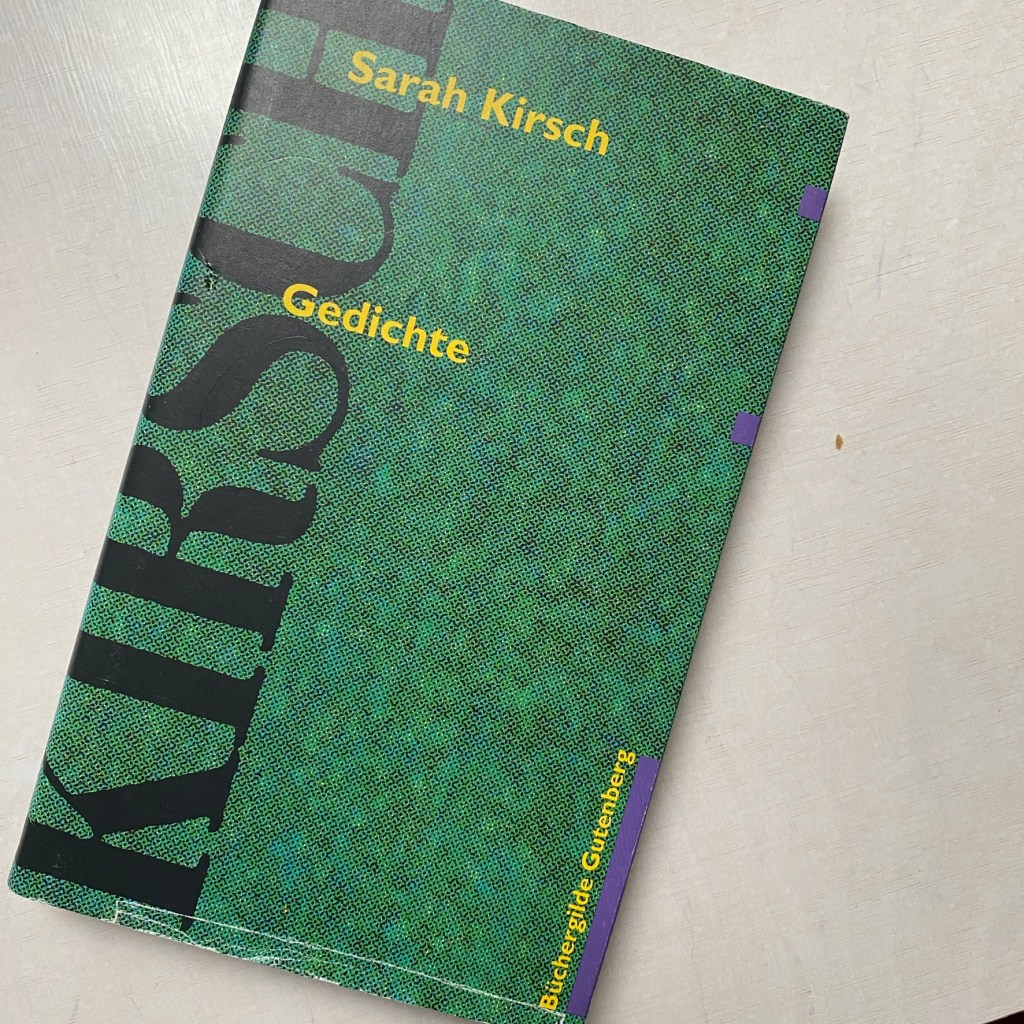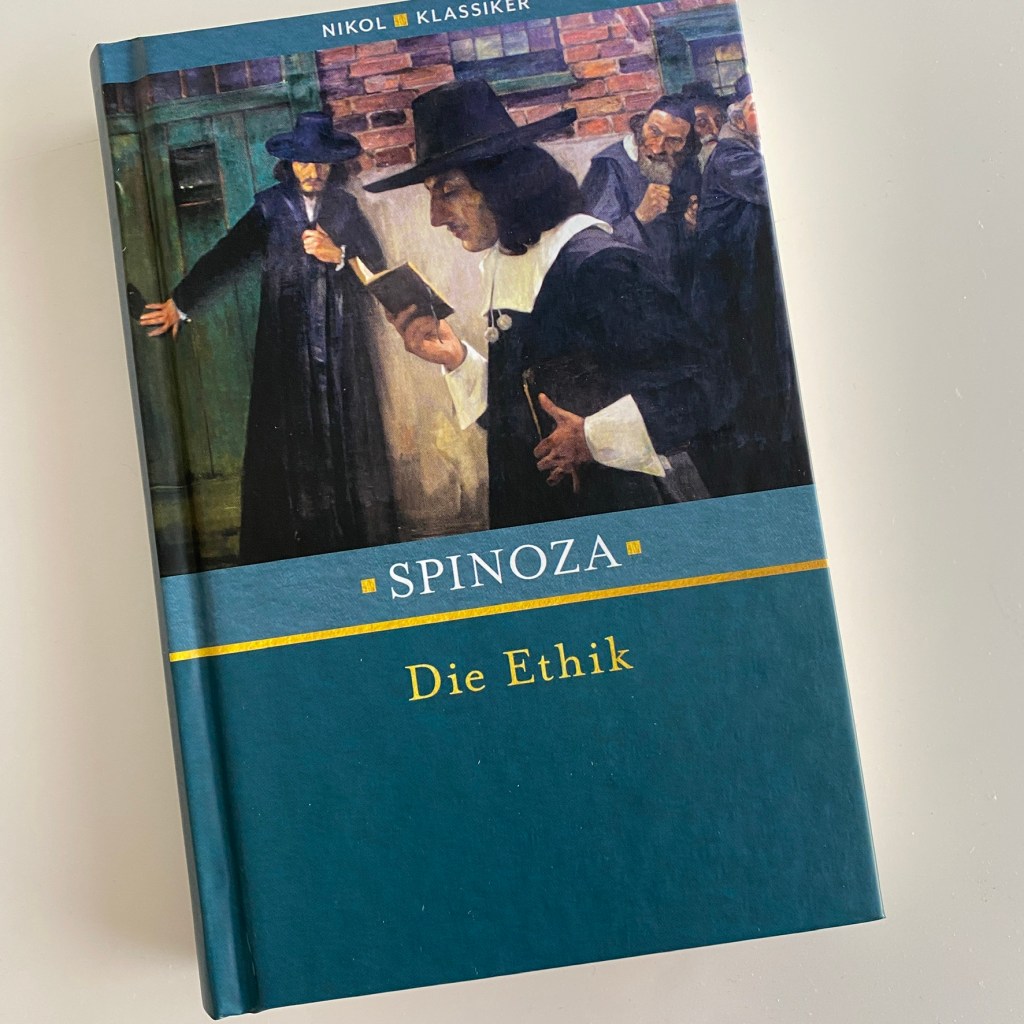Sunil Mann wird am 21. Juni 1972 im Berner Oberland/Schweiz als Sohn indischer Einwanderer geboren. Er verbringt seine Jugend bei Pflegeeltern in Spiez und besucht in Interlaken das Gymnasium. Nach einem erfolgreichen Studienabbruch in den Fächern Psychologie und Germanistik (in Zürich) versucht er sich im Gastgewerbe mit einem halbherzigen Besuch der Hotelfachschule Belvoirpark. Danach arbeitete er 20 Jahre als Flugbegleiter, unterbrach aber immer wieder für mehrmonatige Aufenthalte im Ausland (Israel, Ägypten, Japan, Indien, Paris, Madrid, Berlin, etc.), so dass er genügend Zeit zum Schreiben hatte. Er wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Seit 2018 lebt er als freischaffender Autor in Zürich, wo er sein Heim mit einer wachsenden Anzahl Bücher und Ginflaschen teilt.
Wer bist du? Wie würdest du deine Biografie erzählen?
Aufgewachsen in einer eher ländlichen Umgebung, ziemlich behütet, andererseits aber auch von klein auf an eine besondere Familiensituation gewohnt. Das Pendeln zwischen den sehr schweizerischen Pflegeeltern und meiner sehr indischen Mutter gehörte zu meinem Leben, und dieser konstante Spagat zwischen den Kulturen hat mich nachhaltig geprägt. Schon früh wusste ich, dass ich schreiben wollte. Da damals aber keine Ausbildung in der Richtung existierte, musste ich meinen Weg selber finden. Was ich im Moment als enorm mühsam empfand. Im Nachhinein hat sich das aber als Vorteil erwiesen. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, die mir jetzt noch zugutekommen. Dieser Weg hat mich auch gelehrt, mich für mein Ziel einzusetzen, Frusttoleranz zu entwickeln und mich nicht von Fremdmeinungen beirren zu lassen.
Du sagtest in unserem letzten Interview, dass Schreiben für dich nicht nur ein Hobby sei, das zum Beruf wurde, sondern etwas, das dein Leben reicher macht. Würdest du das noch so sehen? Oder anders: Wieso schreibst du?
Das würde ich immer noch unterschreiben. Ich kann mir keine Tätigkeit vorstellen, die mich glücklicher macht als Schreiben. Ich tue das, weil ich erstens glaube, dass ich es kann. Mittlerweile habe ich Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Genres gesammelt und gemerkt, dass Schubladen eine sinnlose Erfindung engstirniger Menschen sind. Zweitens bin ich – nicht zuletzt aufgrund meiner Biografie – in der Lage, Dinge zu erzählen, die sonst niemand erzählt, Themen anzusprechen wie zum Beispiel Alltagsrassismus, um die die meisten anderen Autor*innen (und auch die Medien, notabene) einen grossen Bogen machen. Und drittens zahlt es die Miete und den einen oder anderen Drink.
Woher holst du die Ideen für dein Schreiben? Natürlich erlebt und sieht man viel, aber wie wird eine Geschichte draus?
Ideen kommen überallher. Sei es ein Zeitungsausschnitt, ein unfreiwillig mitgehörtes Handygespräch im Tram, Netflix oder auch mal von einem Roman, den ich gelesen habe. Eine Idee allein reicht allerdings in der Regel nicht für ein ganzes Buch (es gibt da Ausnahmen), meist ist es bloss ein Denkanstoss, von dem aus sich dann irgendwie eine eigenständige Geschichte entwickelt. Wie genau, habe ich immer noch nicht herausgefunden. Mein Gehirn macht das selbstständig, sobald der Druck (nahende Abgabetermine!) gross genug ist.
Wenn du auf deinen eigenen Schreibprozess schaust, wie gehst du vor? Entsteht zuerst ein durchdachtes Gerüst oder aber schreibst du drauflos und schaust, wo dich das Schreiben hinführt?
Auch wenn das in gewissen literarischen Kreisen verpönt ist, arbeite ich fast immer mit einem Plot. Also einem vorskizzierten Ablauf einer Geschichte. Gerade bei Kriminalromanen ist das sehr hilfreich, damit man sich nicht in der Handlung verliert oder zu geschwätzig wird. Allerdings verändert sich dieser Ablauf, sobald ich mit dem Schreiben beginne. Da kommen mir plötzlich Dutzende neuer Ideen. Es gilt dann abzuwägen, was hineingehört und was man besser weglässt. Damit verändert sich zwangsläufig die Storyline. Ich habe vermutlich noch nie das Buch geschrieben, das ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Die Ausnahme ist „In bester Absicht“, mein erster „literarischer“ Roman. Da habe ich ohne Plot gearbeitet und stattdessen diverse Szenen separat geschrieben, sie dann zusammengehängt und anschliessend die inhaltlichen Lücken gefüllt.
Wenn man an Schriftsteller denkt und auch Interviews von früher liest, schreiben viele die ersten Entwürfe von Hand, oft sogar mit dem immergleichen Schreibmaterial (Legal Pad und Bleistift oder ein bestimmter Füller). Wie sieht das bei dir aus? Stift oder Tasten?
Der grösste Teil der Vorarbeit findet bei mir im Kopf statt. Ich überdenke die Geschichte, die ich erzählen will, so oft, bis sie zu mir gehört, bis ich sie richtig spüren kann. Dann erst schreibe ich einen Handlungsablauf auf, immer auf dem Laptop.
Ich hörte mal, der grösste Feind des Schriftstellers sei nicht mangelndes Talent, sondern die Störung durch andere Menschen. Brauchst du zum Arbeiten Stille und Einsamkeit, oder stören Sie andere Menschen nicht?
Ich bevorzuge Stille, im Café oder im Zug muss ich immer den Gesprächen ringsum zuhören. Ausserdem fände ich es wahnsinnig prätentiös, mit dem Laptop in der Öffentlichkeit rumzusitzen und die Welt wissen zu lassen, dass ich Schriftsteller bin.
Meiner Ansicht nach ist aber der grösste Feind eines Autors nicht die Umwelt, sondern mangelnde Disziplin.
Was sind für dich die Freuden beim Leben als Schriftstellerin, was bereitet dir Mühe?
Dass ich vom Schreiben leben kann und dass es mir immer noch Spass macht, ist ein Privileg. Das bedeutet auch eine gewisse Freiheit. Wenn ich die Nase voll habe von Zürich und seinem Wetter, kann ich auch mal irgendwo an die Sonne reisen und dort weiterarbeiten. Und ich liebe es, mich in Themen zu vertiefen, zu recherchieren. Mühe macht mir eigentlich fast nichts, höchstens vielleicht der ganze Bürokram, den ich natürlich auch erledigen muss, Auftraggebern nachrennen, die vergessen, die Gagen zu zahlen, die Steuererklärung.
Du hast in verschiedenen Genres geschrieben, vom Krimi über Kinderbücher bis hin zur Liebesgeschichte nun. Wieso dieser Wechsel?
Mich treiben beim Schreiben hauptsächlich zwei Dinge an: Neugier und Lust. Deswegen probiere ich gerne neue Dinge aus, bewege mich auch mal aus der Komfortzone raus in unbekannte Gefilde. Was ich nie sein wollte, ist ein One-Trick-Pony, also jemand, der immer genau dasselbe macht. Glücklicherweise wird das auch vom Publikum akzeptiert.
Es gibt die Einteilung zwischen hoher Literatur und Unterhaltungsliteratur (was oft einen abschätzigen Unterton in sich trägt). Was hältst du von dieser Unterteilung und hat sie einen Einfluss auf dich und dein Schreiben?
Ich finde das eine erschreckend antiquierte Haltung, die dringend abgeschafft gehört. Im englischen Sprachraum existiert sie schon lange nicht mehr. Dort werden auch Kriminalromane mit renommierten Literaturpreisen ausgezeichnet, Kinderbücher in wichtigen Tageszeitungen besprochen. Was hierzulande wohl bei manchen für Schnappatmung sorgen würde. Gewisse Entscheidungsträger*innen klammern sich krampfhaft an diese Unterteilung, wobei – mir zumindest – nicht ganz klar ist, weshalb. Es gibt in allen Bereichen hervorragende Werke, aber natürlich auch Schrott. Gerade bei der Vergabe von wichtigen Literaturpreisen, die der Sichtbarkeit zuträglich sind, eine Vielzahl von Genres systematisch auszuschliessen, zeugt von einer unglaublichen Ignoranz. Vermutlich müssen wir einen Generationenwechsel in den Feuilletons und Literaturgremien abwarten, bis sich diesbezüglich etwas ändert.
Du bist immer wieder in Schulen, liest da vor Klassen. Wie bist du dazu gekommen und was reizt dich daran?
Ich habe mittlerweile vier Kinderbücher und zwei Jugendbücher geschrieben. Lesungen für diese Altersgruppen (vor allem für Jugendliche) funktionieren in der Regel nicht so gut als öffentliche Veranstaltungen. Gerade die älteren bringt man kaum dazu, freiwillig eine Lesung zu besuchen. Glücklicherweise setzen aber viele Schulen auf Leseförderung und laden dazu Autor*innen ein. Hinzu kommen all die kantonalen und regionalen Organisationen, die in ihren Programmen grossflächig Schullesungen anbieten. Das ist zwar zeitweise anstrengend, weil es bis zu vier Lesungen pro Tag sind, andererseits macht es mir auch Freude, den Lernenden zu zeigen, dass Literatur nicht zwangsläufig trocken und langweilig sein muss. Und die Diskussionen im Anschluss sind sehr bereichernd, man bekommt Einblick in die Welt der heutigen Jugend.
Eine neue Studie zeigt, dass das Leseverhalten von Schweizer Kindern zu denken gibt, das Leseverständnis ist bei einem Viertel der Kinder stark eingeschränkt bis teilweise gar nicht vorhanden. Wie erlebst du das?
Das ist leider schon länger so. Man darf auf gar keinen Fall verallgemeinern, aber es gibt Schüler*innen, die nicht in der Lage sind, einer Erzählung zu folgen. Entsprechend fehlt dann auch das Verständnis, das heisst, sie wissen im Anschluss nicht, was ich ihnen vorgelesen habe. Meiner Meinung nach hat das auch damit zu tun, dass ihnen zu Hause nie jemand vorgelesen hat. Was wiederum oft mit der beruflichen Situation der Eltern zusammenhängt und ob diese selber lesen. Das Gelesene kurz zusammenzufassen, hilft da teilweise, aber das Kernproblem ist damit natürlich bei Weitem nicht gelöst.
In Amerika sind Kurse in kreativem Schreiben schon lange populär, in unseren Breitengraden scheint immer noch die Idee vom Genie vorzuherrschen und das Lernen des Handwerks wird eher stiefmütterlich behandelt. Ist Schreiben lernbar? Und wenn ja, wieso scheint das fast verpönt bei uns?
Grundsätzlich ist alles lernbar, davon bin ich überzeugt. Ob man dann auch gut in dem Bereich ist, hängt davon ab, wie viel Talent vorhanden ist, ob man was zu erzählen hat und inwiefern man bereit ist, sich wirklich ins Zeug zu legen. Wichtig ist dabei, dass man eine eigene Sprache entwickelt, eine eigenständige Art des Erzählens. Dass es bei uns so wenig Angebote dazu gibt, hängt womöglich damit zusammen, dass man in der Schweiz künstlerischen Tätigkeiten gegenüber eher misstrauisch eingestellt ist. Ich werde oft gefragt, ob ich auch einen richtigen Beruf habe.
Du bietest auch Schreibworkshops für junge Erwachsene an. Wieso die Einschränkung?
Das ist eigentlich immer die Entscheidung des Veranstalters. Ich werde im Frühjahr 2024 wieder einen Kurs im Literaturhaus Aargau geben, der sich explizit an junge Erwachsene richtet. Und einen an der Octopus Schreibschule in Zürich für Kinder zwischen neun und zwölf. Aber es gibt etliche Workshops für Erwachsene. Bei Octopus, aber auch in der Geschichtenbäckerei oder bei Schreibszene.ch
Was rätst du einem (jungen) Menschen, der ernsthaft ein Buch schreiben möchte?
Sich erst einmal zu überlegen, was er schreiben möchte, wie die Geschichte verlaufen soll. Vor allem das Ende ist wichtig, damit er nicht unterwegs plötzlich steckenbleibt. Und dann gibt’s nichts anderes als sich hinzusetzen und zu schreiben. So regelmässig wie irgend möglich.
Herzlichen Dank, lieber Sunil, für deine Zeit und diese aufschlussreichen Antworten!
Sunil Manns Homepage: https://www.sunilmann.ch/