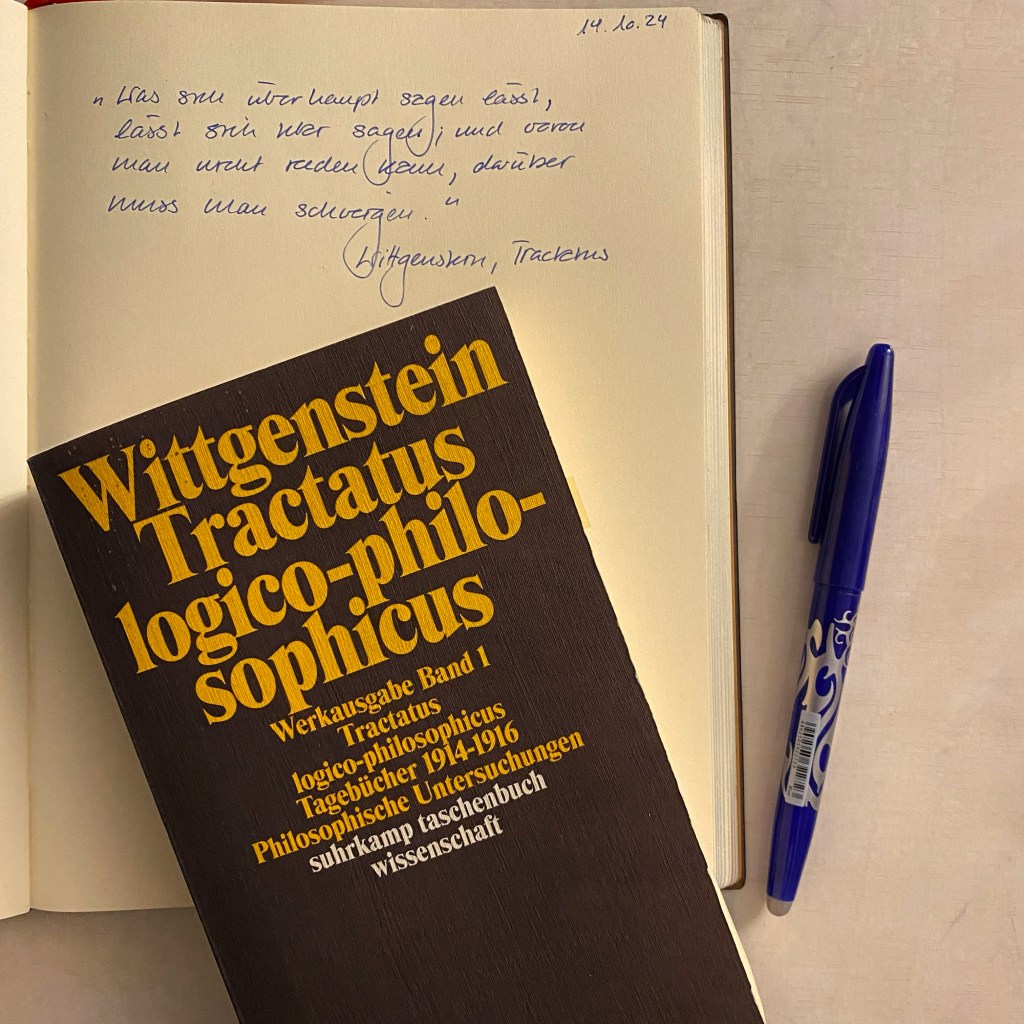Lieber Papa
«Sie haben etwas gefunden.»
Das waren Mamas Worte am Telefon. Ich ahnte Böses und fragte doch. In mir schrie alles «Krebs».
«Auf der Lunge. Sie machen eine Biopsie. Morgen ist ein Gespräch mit dem Arzt. Kommst du?»
Wieder die gleichen Menschen an der Bushaltestelle, ich eine von ihnen. Die täglichen Fahrten waren zu einem neuen Alltag geworden. In der Nacht hatte ich getan, was man in einer solchen Situation vermeiden sollte: Ich hatte über Lungenkrebs recherchiert. Nun wusste ich viel. Zu viel.
Im Zug steuerte ich zielgerichtet meinen Stuhl an. Ich grüsste die Menschen um mich. Wir kannten uns von den täglichen Fahrten. Ich war der Neuling, die anderen die Alteingesessene. Aber ich gehörte nun auch dazu. Ein neues Gefühl.
«Du musst nicht immer kommen. Es ist so weit. Du hast doch auch anderes zu tun.»
«Nun geht es um dich, Papa. Das ist wichtig.»
Du wusstest, wie ungern ich reise. Wie schwer mir das sonst fiel. Als du gesund warst, kam ich selten, weil mir der Weg zu beschwerlich war. Und ja, ich hatte wirklich immer zu viel um die Ohren mit diversen Jobs und Baustellen. Die waren nicht weg und doch war alles anders. Ich wusste, dass es dir etwas bedeutete, wenn ich kam. Und so war es auch für mich.
Ich sah Mama schon von weitem. Sie wartete vor dem Krankenhaus auf mich. Wir begrüssten uns wie immer. Distanziert.
«Danke, dass du gekommen bist. Mich überfordert das alles.»
«Kein Problem. Das ist selbstverständlich.»
Ich meinte es so. Wir holten dich in deinem Zimmer ab und setzten uns ins Zimmer des Arztes.
«Da sitzen wir nun.»
Hörte ich dich sagen. Mehr fiel keinem ein. Keiner traute sich, zu sagen, was er dachte. Als wäre das Aussprechen der Ängste und Möglichkeiten schon der erste Schritt, Tatsachen zu schaffen.
«Was ist, wenn es Krebs ist? Kann man etwas tun? Wirst du sterben? Wie viel Zeit haben wir noch?»
Und vor allem:
«Wie soll ich weiterleben ohne dich?»
All das sagte ich nicht. Ich schwieg. Erzählte dann von der Busfahrt. Vom Wetter in Zürich. Vom Zug. Smalltalk wie bei einer Party an einem lauen Sommerabend.
Die Tür ging auf, der Arzt kam herein. Er schaut uns an.
«Wir haben nun die Untersuchung gemacht.»
Pause. Wieso rückte er nicht raus? Das hier war kein Thriller und wir brauchten keine künstliche Spannung.
«Es ist Krebs.»
Scheisse. Ich sagte es nicht. Wir schwiegen. Schauten ihn nur an. Warteten.
«Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass er nicht gestreut hat. Wir werden ihn mit Chemotherapie behandeln, damit der Tumor kleiner wird, um ihn dann operativ zu entfernen. Das sollte kein Problem sein.»
Krebs und Glück. Was für eine Kombination. Ich nickte.
«Das klingt doch schon mal gut.»
Sagte ich und glaubte es nicht. Ich wollte es wohl glauben. Und ich wollte, dass du es glaubst. Schliesslich mussten wir nun an das Gute glauben, den Rest hatten wir frei Haus geliefert bekommen. Daran mussten wir nicht mehr glauben. Das war schon da.
«Wie geht es nun weiter?»
Der Arzt erklärte das Vorgehen, es erschien mir nicht logisch, aber Krebs hatte wohl keine Logik. Für einmal konnte ich mich nicht hinter Theorien und logischem Denken verkriechen. Ich musste akzeptieren, dass wir keine Wahl hatten.
«Gut, dann machen wir das so.»
Ich sagte wir. Dabei warst du es. Du schwiegst. Nicktest nur leicht mit dem Kopf. Ein leises Begreifen des Ausmasses? Irgendwie schienen wir plötzlich alle krank. Du tatsächlich und wir als Co-Kranke.
«Leider wissen wir noch nicht, wie es zu den Sprachaussetzern gekommen ist. Den Lungenkrebs haben wir nur per Zufall entdeckt, als wir die Ursache für die Hirnschläge suchten.»
«Dann kann das jederzeit wieder passieren?»
«Theoretisch ja.»
Da war etwas in dein Leben gekommen, hatte dir, der du eh schon ein Schweiger warst, die Sprache genommen. Und nun suchten wir alle nach Worten, damit umzugehen. Und sie wollten sich nicht einfinden. Nicht die richtigen. Die gab es nicht.
(«Alles aus Liebe», XXXXI)