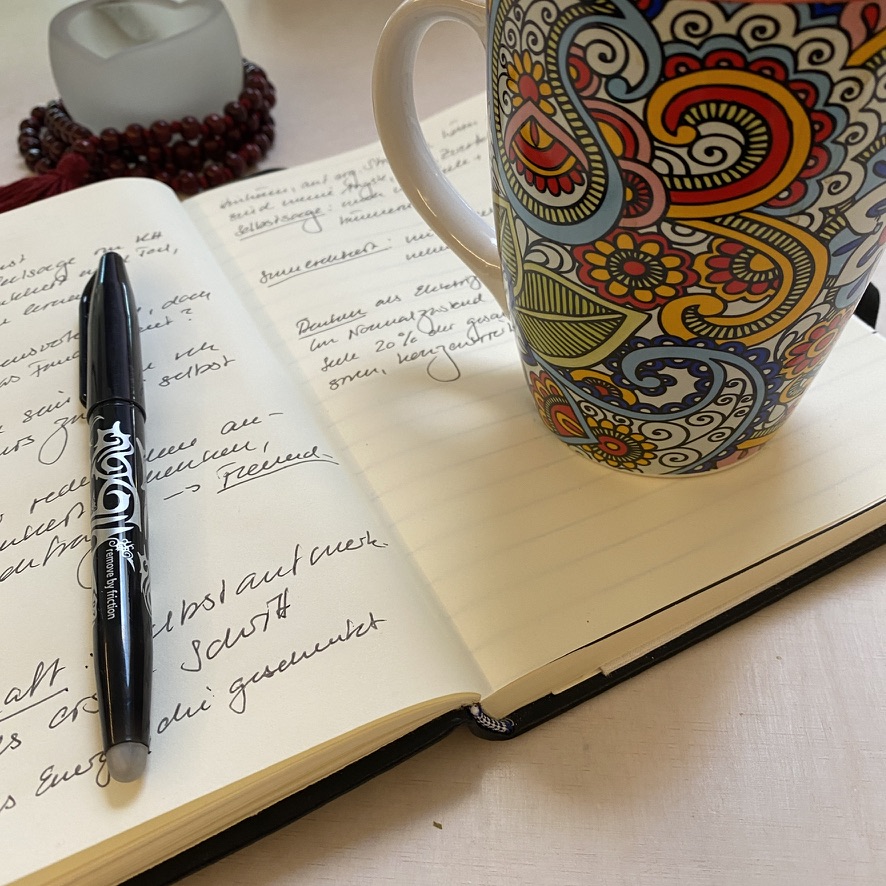Wenn wir am Abend auf den Tag zurückschauen, bewerten wir diesen oft und denken „das war ein guter Tag“ oder „das war ein schlechter Tag“. Was bestimmt darüber, ob ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Leben gut sind? Was macht das gute Leben aus? Diese Frage beschäftigt nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch die Philosophie seit Jahrhunderten (viele halten ja die Philosophie für dem Leben fern, doch ich würde sie gerne wieder ins Leben holen, denn da gehört sie hin). Schaut man in die Geschichte der Philosophie, gibt es deswegen viele Antworten:
Aristoteles erachtete die Glückseligkeit als höchstes Ziel, das es für die Eudaimonia, das gute Leben, brauche. Diese ist das Ziel allen Handelns des Menschen. Bei Platon findet sich die Idee des tugendhaften Lebens, welches ein gutes sei. Er sieht die Erfüllung des Menschen darin, nach dem Guten und Gerechten zu streben, welches als vollkommen Gutes nur als Idee existiert, an welche sich der Mensch anzunähern versucht. Dieses wirke sich dann wiederum auch auf die Gesellschaft aus. Epikur wich ab vom Gedanken, dass es etwas von aussen zu bestimmendes Gutes gibt, für ihn war das Gute nichts Objektives, sondern etwas, das jeder für sich selber bestimmen müsse. Schon in der Stoa drehte der Wind wieder und das Gute wurde objektiv: Alles steht mit allem harmonisch im Zusammenhang, was nicht passt, ist nicht gut. Der Mensch führt also ein gutes Leben, wenn er sich in diesen harmonischen Zusammenhang eingliedert. Die Skeptiker wiederum verneinten eine Einteilung in gut und schlecht, da man schlicht nicht gesichert wissen könne, was nun wahr sei.
Später äusserten sich dann die Kirchen und Kirchenanhänger zu dem Thema, in der frühen Neuzeit kamen wieder die Philosophen ins Spiel. Es dominierte die Sicht, dass es kein objektiv Gutes gäbe, dieses sei immer subjektiv gesetzt. Spinoza befand in diesem Sinne, es werde nichts angestrebt, weil es gut sei, sondern es sei gut, weil man es erstrebe. Sprich, der Mensch bewertet ein Ding als gut und will es dann haben, das Ding an sich ist nicht objektiv gut. Noch weiter ging Leibnitz, welcher die Welt als eine der besten betrachtete, so das die Wirklichkeit das Gute darstelle, während alle Theorien dahinter zurück blieben. Locke machte das Gute am Glück fest, indem alles gut sei, was Glück bringe.
Für Hume war das alles zu viel Vernunft, denn er war der Überzeugung, dass man das Gute nur fühlen könne, der Verstand hätte keinen Einfluss diesbezüglich. Damit kam er dem rationalen Kant gerade recht: Für diesen waren solche Gefühlsduseleien nichts, er sprach das Gute dem Willen zu, welcher gut sei, insofern er aus vernünftigen Beweggründen heraus moralisch handeln wolle. Nicht das Gute bestimmt also die Moral, sondern diese das Gute. Auch das war nicht der Weisheit letzter Schluss: Hegel war das zu abstrakt, er befand, man könne die Wirklichkeit und das Richtige, Natur und Moral, nicht trennen. Das Gute finde man in der Wirklichkeit einer sittlichen Gesellschaft, in die der Einzelne eingebunden sei.
Schopenhauer gähnte ob all dem, befand es als trivial, da gut nach ihm das ist, was dem entspricht, was man will – jeder bastelt sich also sein Gutes selber zusammen. Nietzsche ging noch weiter und befand den guten Menschen im Sinne von Sitten und Moral als dekadent, da diese Haltung lebensverneinend sei. Später kamen noch Vertreter des Glücks und der Freude dazu, welche für ein gutes Leben ausschlaggebend seien – langer Rede, kurzer Sinn: Was denn nun? Was also ist der Sinn des Lebens? Natürlich kann hier keine abschliessende und absolut gültige Antwort auf die Frage gegeben werden. Das Folgende ist der Versuch einer Antwort, die eine Meinung nach aktuell gültigem Stand des persönlichen Nachdenkens darstellt.
Heute hat man oft den Eindruck, dass sich ein gutes Leben über den Konsum bestimmt: Wenn ich alles haben kann, was ich will, ist das Leben gut. Dass dies nur ein flüchtiges Gut ist, blendet man aus, da man den Effekt ja wiederholen kann – und muss. Das alles ist wohl eher ein Ersatz dafür, dass man Wert und Sinn nicht findet oder gar nicht suchen will, da die Frage zu gross und damit zu überfordernd wirkt. Worauf sollte man sich berufen? Nicht mal die alten Philosophen waren sich einig, jeder befand etwas anderes. Was ist wichtig für ein gutes, für ein gelingendes Leben? Es müsste wohl so aussehen, dass wir als Menschen das Gefühl haben: „So ist es gut, so kann es bleiben.“ Es müsste uns also in dem befriedigen, was uns wichtig ist, was für uns stimmig ist, was uns ausfüllt und das Gefühl gibt, als richtiger Mensch am richtigen Ort zu sein. Unser Dasein müsste für uns einen Wert haben, und wir brauchen das Gefühl dass dieser Wert auch anerkannt wird. Nur fühlt es sich sinnvoll an, dieses Leben zu leben. Damit wären wir bei Wert und Sinn angelangt – was bedeuten sie konkret in Bezug auf das gute Leben?
Eine einfache Antwort darauf gibt es wohl nicht, zumindest keine, die man von aussen allgemein äussern könnte. Vielleicht können uns die Existenzialisten weiterhelfen: Sartre erachtete das Leben an sich als sinnlos. Leben sei reine Existenz und die komme vor der Essenz, also vor einer Zuschreibung irgendwelcher Eigenschaften. So gesehen erhält das Leben erst dadurch einen Sinn, dass wir ihm diesen zuschreiben. Das heisst also, wir finden den Sinn in uns selber und versuchen dann, ihn im Leben zu verwirklichen. Er hängt von uns selber ab, davon, wer wir sind oder sein wollen. Dazu Sartre:
„…der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf, er existiert nur in dem Mass, in dem er sich verwirklicht, er ist also nichts anderes als die Gesamtheit seiner Handlungen, nichts anderes als sein Leben.“
Ein Zirkelschluss? Der Mensch bestimm das Leben, welches er zugleich ist? Nein, es stellt eher eine Möglichkeit dar, frei zu sein, weil jeder Mensch sein kann, was und wer er sein will. Wenn er also weiss, was für ein Mensch er sein will, kann er entsprechend handeln und erfüllt so sein Selbstbild, er erschafft sich selber. Auf diese Weise lebt jeder Mensch das, was er für sich als gut und richtig erachtet, er verfolgt die Ziele, welche er für sich als wertvoll festlegt und gibt so seinem Leben Sinn.
Harald Welzer hat die Frage anders formuliert: Wer möchte ich gewesen sein? Dieses Futur II lässt durch den Blick in die Zukunft die Gegenwart gestalten. Indem ich weiss, wie ich mal auf mich zurück blicken möchte, kann ich das Leben gestalten, das dem entspricht. Darin liegt eine grosse Selbstwirksamkeit, das Gefühl, mich und mein Leben nach meinem Sinn gestalten zu können, so dass es ein gutes Leben ist.
Nur: Der Mensch ist keine Insel ist, sondern er lebt immer in einer Gemeinschaft, auf die und deren Anerkennung er angewiesen ist. Aus diesem Grund wird der einzelne Mensch wohl ein Mensch sein wollen, der in seinem sozialen Umfeld eingebettet ist, der sich in diesem entfalten kann und auf gegenseitige Resonanz im Sinne von gelebter Beziehung und einem Miteinander angewiesen ist. Damit er sich selber auf seine Weise gestalten kann, sein Menschsein nach seinen Vorstellungen verwirklichen kann, bedarf es einer Gesellschaft auf Augenhöhe, einer Gesellschaft, in der die Freiheit des Einzelnen gewährleistet ist, weil keiner den anderen beherrscht.
All das berücksichtigt kommen wir zum Schluss, dass das gute Leben das Leben ist, welches für den Einzelnen Sinn ergibt, indem er sich diesen selber gibt durch seine Vorstellung des eigenen Seins, eingebettet in eine Gemeinschaft von ihm Gleichgestellten, die sich gegenseitig die Freiheit lassen, dies zu tun. Sollte die Gesellschaft noch nicht an dem Punkt sein, so können wir diese nicht von heute auf morgen ändern, aber wir können – jeder für sich – bei uns selber anfangen und uns dafür einsetzen, dass dies auch für andere möglich wird.