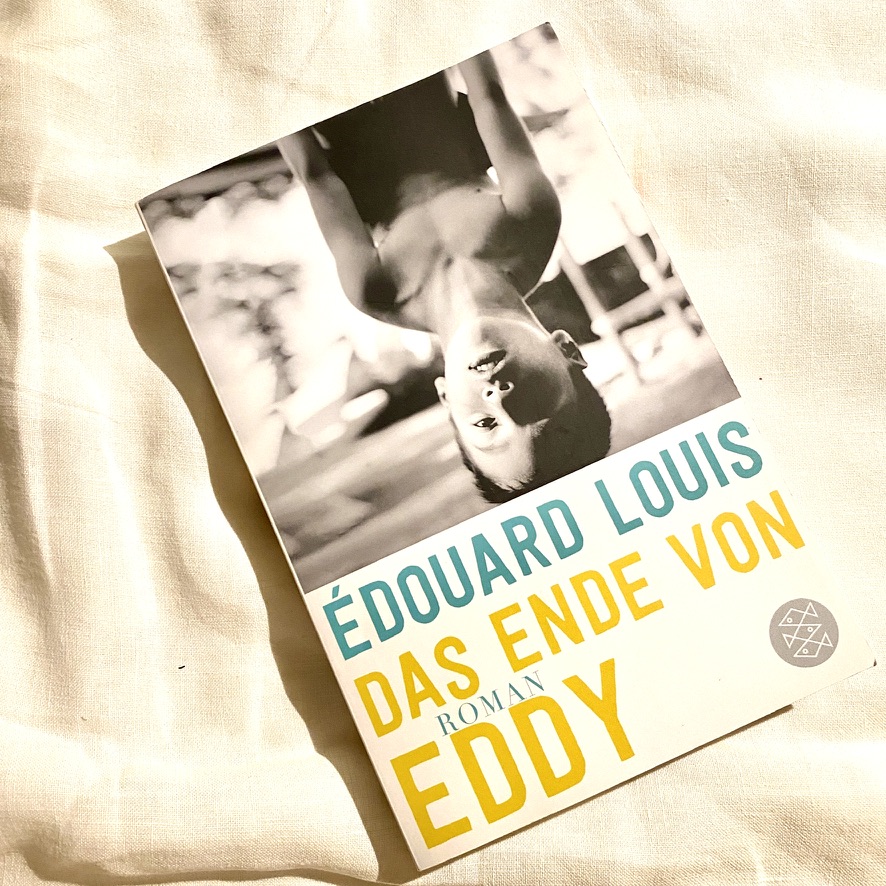Lieber Papa
Gerade hatte ich Lust auf einen Kaffee. Nun steht er neben mir, dampft vor sich hin und riecht gut. Ich liebe den Geruch von Kaffee. Es gibt Tage, da trinke ich viel Kaffee, an anderen nur wenige. Ohne Muster, ohne Regeln. Anders als früher. Bei euch. Ihr trankt genau drei Kaffees am Tag. Ich durfte keinen. Den ersten Kaffee gab es zum Frühstück. Ich musste Milch trinken. Zuerst mit Schokolade drin, es war grässlich. Ich kotzte fast. Danach durfte ich wenigstens die Schokolade weglassen. Der Brechreiz blieb. Begleitet von einem Schütteln, das durch den ganzen Körper fuhr. Den zweiten Kaffee trankt ihr nach dem Mittagschlaf. Dazu gab es drei Guetzli. Nicht zwei oder vier. Drei. Schummeln ging nicht. Du hast es bemerkt.
In der Büchse war immer eine Mischung von zwei bis drei Sorten. Jeder durfte sich drei aussuchen. Irgendwann waren nur noch die da, die am wenigsten bliebt waren. Die mussten gegessen sein, bevor es neue gab. Und trotzdem wurde die Sorte immer mal wieder gekauft. Den dritten Kaffee gab es am Abend. Da war ich schon im Bett und ihr kurz davor, dahin zu gehen. Die drei Guetzli habe ich jeweils verpasst. Das war nicht schlimm. Ich mochte die meisten Guetzli nicht so sehr. Es war viel weniger Schlimm als die Milch zum Frühstück. Die ich bekam, um stark und gesund zu sein. Und mich beim Trinken weder noch fühlte.
Das Abzählen gab es auch an anderen Orten. Mami zählte die Cherrytomaten für den Salat ab. Fünf pro Person. Nicht wie ich. Ich schütte sie einfach rein und höre auf, wenn ich finde, es reicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele es dann sind, es ist eher so ein optisches Mass. Die Rotkleckse im grün gefallen mir.
Salat gab es nur, wenn du zu Hause warst. Wenn Mama und ich allein assen, gab es nur für mich eine Mahlzeit. Mama ass einen Apfel. Damit sie nicht dick würde. Sagte sie. Sie ass ihn immer ganz. Am Schluss war nur noch der Stil da. Das konnte ich nicht verstehen. Der Apfel ist so süss und gut, das Gehäuse so zäh und bitter. Damit zerstört man doch alles? Ich finde, beim Essen muss man mit dem Besten aufhören. So bleibt der Geschmack am längsten präsent. Erinnerst du dich? So ass ich immer. Du mochtest es nie. Ich ass zuerst das, was ich am wenigsten mochte, dann das nächste, am Schluss das Beste. Du hast immer gesagt, gehöre sich nicht. So esse man nicht. Iss anständig, sagtest du. Abwechselnd von allem. Sagtest du. Ich mochte es anders lieber. Wenigstens die letzte Gabel trug immer das Beste. Den Rest musste ich anpassen.
Was ich lernte: Alles hat seine Ordnung. Es gibt bei allem eine Art, wie man es macht. Kein Zufall, keine Masslosigkeit, alles abgemessen. Einfach mal Lust und Laune walten lassen? Wie ich mit meinem Kaffee? Undenkbar.
Ich weiss nicht, wieso das so war. So war es einfach. Und: Regeln waren bei uns nie dazu da, hinterfragt zu werden. Denen musste ich folgen. Ich glaube, Mama auch. Wenn ich das so schreibe, kommen mir Zwangsstörungen in den Sinn. Da gab es doch diesen Krimi, «Monk», in dem die Hauptfigur alles ordnen musste. So schlimm war es nicht bei dir. Und: Es war nicht nur auf dich bezogen, du hast es auf uns erweitert, mich dahingehend erziehen wollen.
Vielleicht war es ein Halt. Befürchtetest du, ihn sonst zu verlieren? Wohin wärst du in deinen Ängsten gefallen, hättest du ihn verloren?
Während ich all diese Erinnerungen aufschreibe, wie sie mir in den Sinn kommen, frage ich mich, was das Ganze bringen soll. Es ist vorbei. Heute ist heute. Sollte ich nicht in diesem so vielbeschworenen Hier und Jetzt leben, statt in Gedanken durch die Vergangenheit zu pflügen wie die Menschen beim Sommerschlussverkauf im Wühltisch? Ich las mal bei einem dieser Life-Coaches, die wie Pilze aus der Erde spriessen, man könne nur an einem Tag leben: Heute. Er versprach mir mit seinem Zahnpastalächeln, mir zu meinem Glück zu verhelfen. Ich liess ihn nicht. Und doch hat der Spruch etwas. Dieses Hier und Jetzt klingt gut. Da ist nichts mehr von früher, das schmerzt. Da kriecht nichts von dem, was man mal unter den Teppich kehrte, wieder hervor. Tabula rasa, das weisse Blatt Papier, das ich neu beschreiben kann. Tag für Tag. Leider funktioniert das Leben nicht so. Da ist immer etwas da. Etwas, das geprägt hat. Sich eingebrannt hat. Etwas, das unter dem Teppich liegt und beim Drüber Gehen schmerzt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Schuhe mit harten Sohlen tragen oder aber mich dem stellen. Ich möchte den Boden spüren. Es bleibt also nur, die Dinge wieder unterm Teppich hervorzuholen.
Das Graben in den Schichten der eigenen Vergangenheit birgt Gefahren. Da sind vergessene Abgründe, die mich erneut in ihren Schlund ziehen wollen. Verdrängte Gefühle, die mich überwältigen. Was lauert da noch im Dunkel des Vergessenen? Will ich mich dem wirklich stellen? Kann ich es? Halte ich es aus? War es nicht gut verstaut da, wo es ist? Aus den Augen, aus dem Sinn?
Aber: Seit ich damit begonnen habe, zu graben, kann ich nicht mehr aufhören. Ich hoffe auf Antworten. Für die offenen Fragen in Situationen, in denen plötzlich etwas aus mir herausbrach, das ich nicht greifen konnte. Das ich nicht verstand. Etwas, das sich den Weg an die Oberfläche bahnte oder mich von innen anstachelte, das von irgendwoher kommen musste. All die Glaubenssätze, Überzeugungen, Einordnungen, an denen ich mich ausrichte, haben eine Herkunft. Ich hoffe, dass ich mehr verstehe, wenn ich sie finde. Ich hoffe, durch das Verstehen auch ein Stück Freiheit zu gewinnen, für meinen weiteren Weg.
(«Alles aus Liebe», XI)