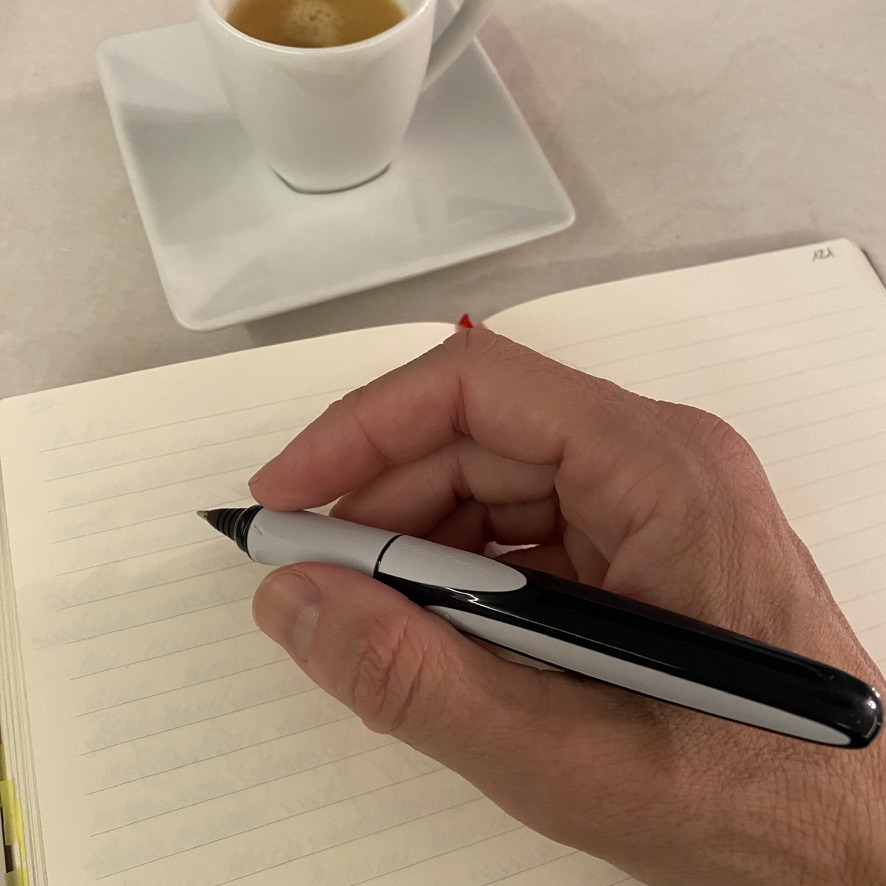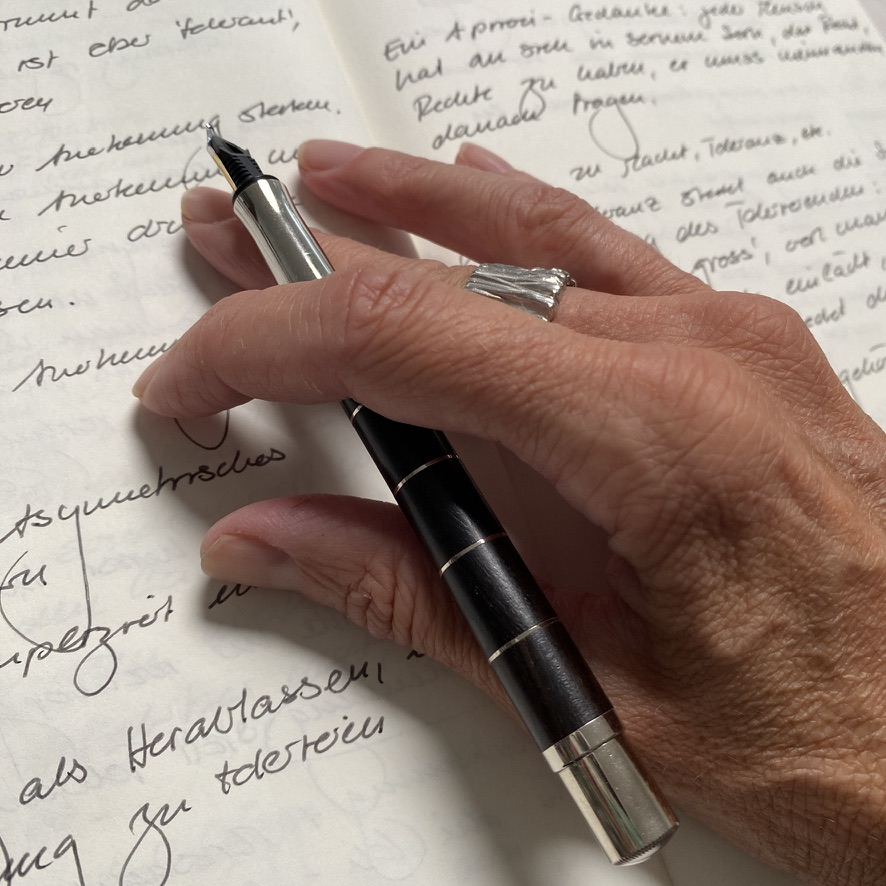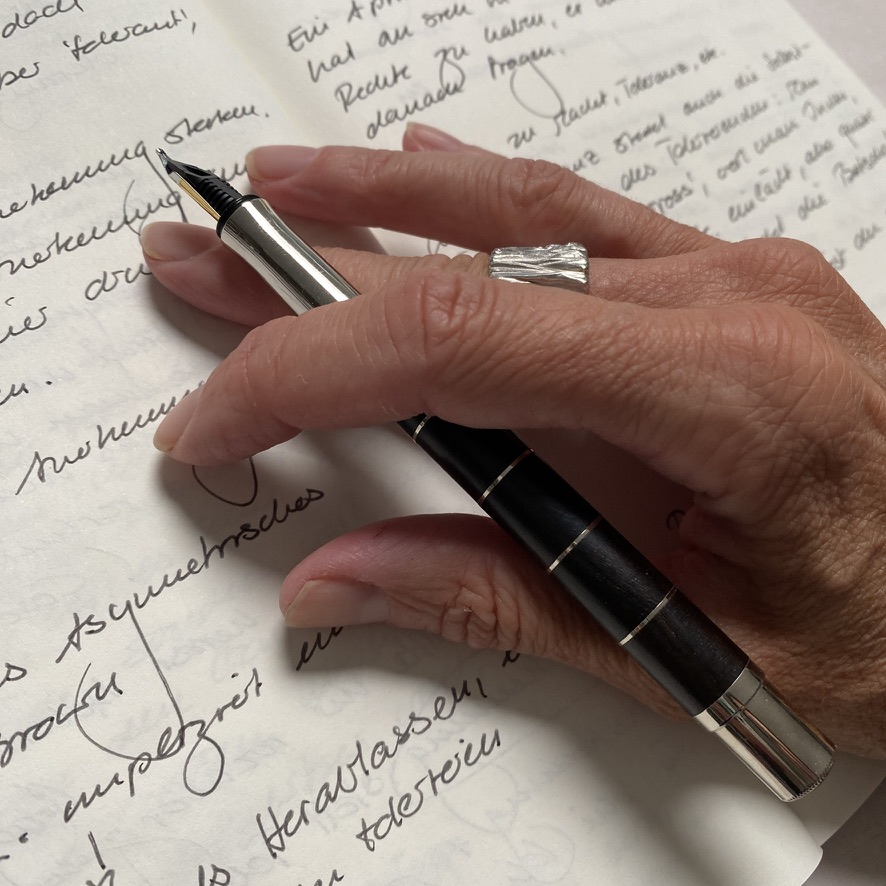Lieber Papa
Immer wieder höre ich Menschen von ihren Erinnerungen sprechen. Sie erzählen Episoden aus der Kindheit, können in epischer Länge und Breite ihr vergangenes Leben Revue passieren lassen, bis weit zurück zum Kindergarten und davor. In der Vergangenheit dachte ich oft, das sei Schnee von gestern. Das interessiere nicht. Wieso soll man zurückblicken, wenn die Gegenwart so viel Neues bietet. Hast du das nicht auch gesagt?
Irgendwann merkte ich, dass mir etwas fehlte. Dass ich mich, selbst wenn ich wollte, nicht erinnern konnte. Wieso war das so? Wo steckten all die Erfahrungen, Erlebnisse meiner frühen Jahre? Irgendwie war da nur eine grosse, stille, schweigende Leere. Wenn ich dann Fotos anschaute, in der Hoffnung, dass sich doch eine Erinnerung regt, blieb alles still. Zwar sah ich mit Bildbeweis, dass etwas da gewesen sein muss, doch das schien nun verloren.
Wenn ich dich manchmal nach früher gefragt habe, half mir das meist wenig. Du schienst die Fragen nicht hören zu wollen, vor allem dann nicht, wenn sie kritisch waren. Du tatest die Fragen ab, erachtetest sie als unnötig, abwegig, unsinnig. «Wieso willst du das wissen? Was willst du damit bezwecken? Willst du etwas kaputt machen, das gut war?», hörte ich dann höchstens. Und die Frage klang nicht nach einer wirklichen Frage, mehr nach einem Vorwurf. Für dich schien festzustehen, dass die Fragen dazu dienten, etwas zu zerstören. Wie kamst du darauf? Ich traute mich nicht, nachzufragen. Du hattest schon alles mit einer Handbewegung weggewischt. In der Handbewegung lag etwas Drohendes. Dein Blick sprach Bände, sie versprachen nichts Gutes. Unfrieden lag in der Luft, ich wollte ihn nicht realisieren. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mich selbst wieder auf die Suche zu machen. Leichter gesagt als getan.
Erinnern ist nichts, was mir in die Wiege gelegt wurde. Bei uns erinnerte man sich kaum. Wir waren eine Familie, die quasi aus dem Nichts entstanden schien, denn da gab es kaum Vorgeschichten, die zirkulierten. Kein „weisst du noch“, keine Erzählungen von Onkeln, Tanten, Grosseltern, Urgrosseltern. Keine Ahnenkette und keine Erinnerungsgegenstände. Es gab nichts Ererbtes und es wurde nichts vererbt. Vermutlich war auch nichts wert genug, es weiterzugeben. Nicht mal die Erinnerungen.
Manchmal wirkte das auf mich, als seien Erinnerungen verpönt als etwas, das man nicht hat. „Wir leben im Jetzt. Was war, ist vorbei“, sagtest du manchmal. Das klang anders als die spirituellen Lehren heutiger Gurus vom Leben im Hier und Jetzt. Es klang weniger nach einem Leben in der Fülle der Präsenz, sondern mehr nach düsteren Abgründen, die man für immer zuschütten wollte, nach abgeschnittenen Bändern, die keiner mehr zusammenfügen sollte.
Manchmal denke ich, dass all diese verdrängten Erlebnisse und verschwiegenen Ereignissen nicht nur das Band zur Vergangenheit kappten. Sie bewirkten auch eine fehlende Bindung zwischen uns. Wo keine Geschichten erzählt werden, wo es nichts gibt, das auf eine gemeinsame Herkunft deutet, spinnen sich keine Fäden, weben sich keine Netze. Hannah Arendt brauchte dieses Bild einmal, als sie sagte, dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, ein Faden im Gewebe der Welt sei. Jeder Mensch hilft, das Weltengewebe zu weben. Ich liebe dieses Bild. Nur: Wenn man das Gewebe entfernt, bleibt ein loser Fade, der haltlos im Wind flattert. Er hat keinen Platz, keine Funktion. Das Leben bleibt auf diese Weise zusammenhanglos und schlecht fassbar. Ich konnte es nicht fassen. Und ich konnte mich in ihm nicht fassen.
Natürlich kannte ich meine Grosseltern, wobei: „kennen“ ist eigentlich das falsche Wort. Ich besuchte sie zusammen mit meinen Eltern, wusste ihre Namen, ein paar Eckdaten aus der Vergangenheit (eine Hand reichte, sie aufzuzählen). Bei den Besuchen redeten immer ihr Erwachsenen. Ich verstand wenig. Mich platziertet ihr auf einem Sofa, gabt mir Farbstifte und Papier. Dadurch hattet ihr für eine Weile Ruhe, denn ich war beschäftigt. Danach gingen wir wieder.
Ich war immer das einzige Kind bei Familienbesuchen. Manchmal kam es mir so vor, als wärt auch ihr nie Kinder gewesen, zumindest habt ihr nie von einer Kindheit erzählt. Von mir habt ihr erwartet, dass ich mich benehme. Das hiess immer, so wie es ein Erwachsener tun würde. Ich fühlte mich nicht wahrgenommen, durfte auf eine Weise auch nicht als ich da sein. Ich war vor Ort, aber auf eine merkwürdige Weise nicht dabei. Vielleicht sollte ich da schon die Erwachsene sein, als die du mich in der Zukunft sehen wolltest? Vielleicht kanntest du es selbst nicht anders? Krieg und Armut waren präsent, auch wenn die Schweiz nicht direkt betroffen war, so hatte all das doch Auswirkungen. Ich weiss es nicht genau. Einzelne Erinnerungsfetzen von wenigen Augenblicken, in denen du davon erzähltest, sind da. Ansonsten war all das kein Thema.
Ich frage ich gerade, wie man in einem Umfeld, in dem es keine Kinder gibt, lernt, was Kindheit ist. Wie lernt man es in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, Kinder möglichst schnell den Vorstellungen der Erwachsenen anzugleichen? Wie ist man Kind, wenn man nur als kleiner Erwachsener in Ordnung ist, wenn das eigene Kindsein die Erwachsenen stört? Immer, wenn ich auf eine Weise Kind war, fandst du, ich falle auf. Das war das Schlimmste: Auffallen. Das galt es, um jeden Preis zu vermeiden.
(„Alles aus Liebe“, IV)