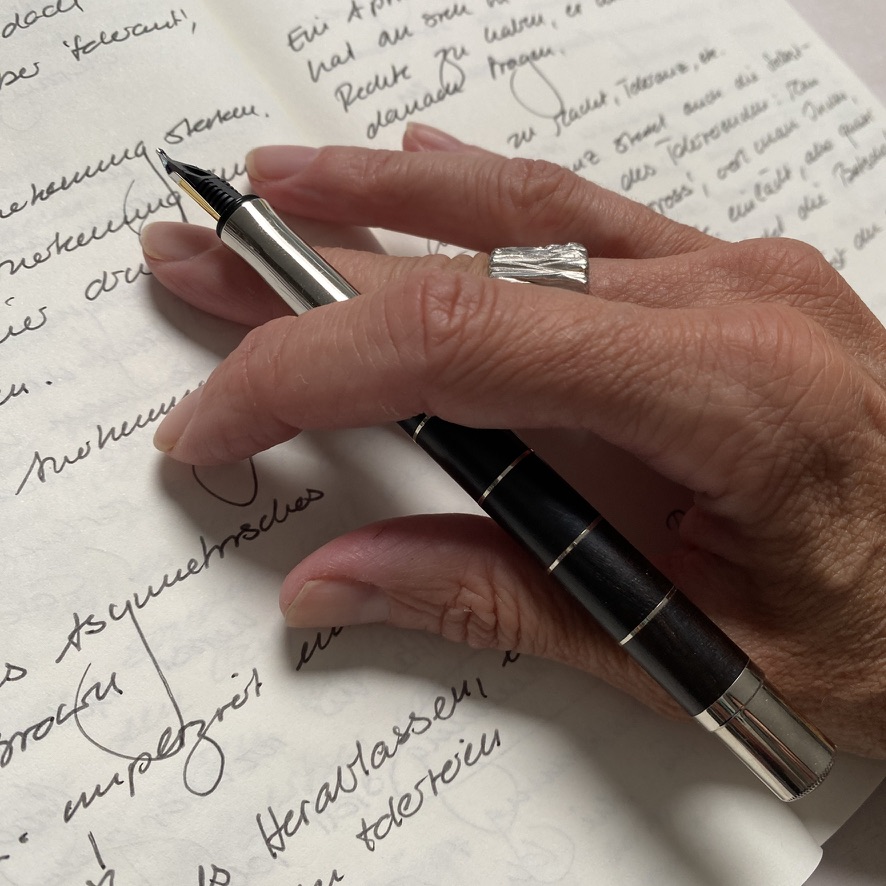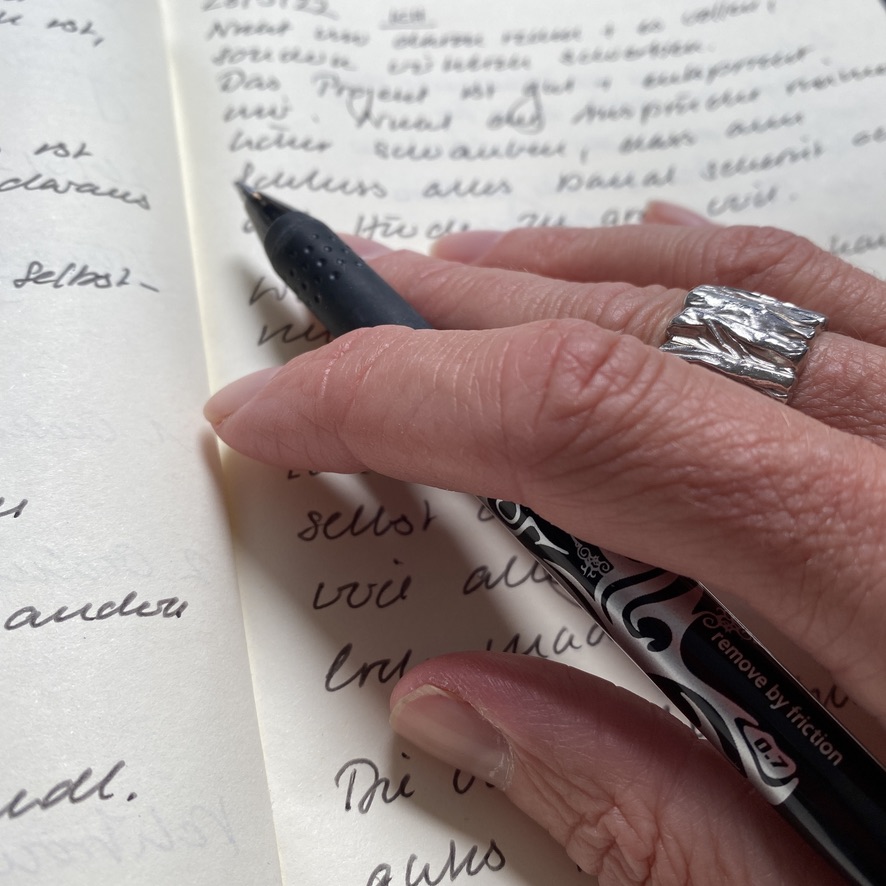Lieber Papa
Kürzlich las ich, dass immer mehr Kinder und Jugendliche ihr Geschlecht ändern wollen, weil sie sich im falschen geboren fühlen. Ich weiss nicht, ob es das gleiche Gefühl ist, das ich auch hatte. Ich wäre lieber ein Junge gewesen. Erinnerst du dich? Du warst alles andere als erfreut darüber. Ich kann meinen Wunsch noch heute verstehen. Damals erschien mir das Leben der Jings spannender. Lebendiger. Die durften mehr. Wild sein. Laut sein. Mit Rennautos spielen. Auf Bäume klettern. Alles, wovon es hiess:
«Du bist doch kein Junge, benimm dich mal, wie es sich für ein Mädchen gehört.»
Aber ich wollte auch laut sein, toben, raufen, klettern. Und ich tat es. Keine Hose war mehr ganz, weil sie alle bei einer Partie über Stacheldraht oder auf die Bäume ihre Blessuren abbekommen haben. Mama musste überall diese Flickflecken draufbügeln.
Am liebsten spielte ich auf dem Spielplatz vor unserem Haus mit einem Jungen. Er hiess Beat. Leider war er nur mein Freund, wenn wir allein waren. Sobald andere Jungs auftauchten, verlor ich diesen Stellenwert. Dann war ich nur noch geduldet. Das tat weh. Ich wäre gerne einer von ihnen gewesen. So ganz. Immerhin durfte ich mitspielen. Ich strengte mich an, verausgabte mich wohl mehr als die anderen, um nicht «das Mädchen» zu sein. Ich zeigte nie, wenn mir etwas zu wild war oder ich mich verletzt hatte und es schmerzte. Bloss nicht zimperlich tun, sonst würden sie mich verachten.
Du liessest mich gewähren. Es gab keine Strafen, nur Ermahnungen, die aber eher halbherzig. Darüber war ich froh, denn ich weiss nicht, was ich sonst gemacht hätte. Grenzen gab es aber: Einmal wünschte ich mir zu Weihnachten eine Autorennbahn. Das sei was für Jungs. Sagtest du. Ich kriegte sie nicht. Was ich stattdessen bekam, weiss ich nicht mehr. Wäre es die Rennbahn gewesen, wüsste ich es. Noch heute schaue ich diese Rennbahnen sehnsüchtig an. Zu gerne hätte ich mal die Autos um die Kurven rasen lassen.
Es gab noch einen anderen Bereich, in denen es doof war, ein Mädchen zu sein: In der Schule musste ich mich mit Nadeln und Fäden rumschlagen, während die Jungs mit Hammer und Säge werkelten. Was habe ich mich gelangweilt. Die Folge war, dass ich die ganzen Stunden nonstop schwatzte im Unterricht. Die Lehrerin war wenig erfreut. Sie ermahnte mich immer wieder, ich solle still sein. Das habe ich nie verstanden. Beim Stricken spricht es sich prima. Zudem: Wenn ich am Werkraum vorbeikam, hörte ich da immer ein wildes Durcheinander von Reden, Lachen und Schaffen, während bei uns nur klappernde Nadeln erwünscht waren. Nun, ich redete trotz Ermahnungen weiter. Ich flog deswegen so manches Mal vor die Tür (wie auch in anderen Schulstunden). Die Handarbeitslehrerin mochte mich eigentlich. Da hatte ich Glück. Gegen Ende des Semesters forderte sie mich immer auf, doch wenigstens nur zu flüstern. Dann könnte sie mir zumindest ein «Gut» im Betragen ins Zeugnis schreiben. Einmal wurde es dann doch «Ungenügend». Ich erinnere mich, wie du dich aufgeregt hast. Für dich war das schlimmer als eine schlechte Note es hätte sein können. Da habe ich mich geschämt. Ich hatte dich enttäuscht.
Fast noch schlimmer als das Häkeln und Stricken selbst waren die Ergebnisse – vor allem im Vergleich mit denen des Werkunterrichts. Während wir Topflappen, Tierchen und ähnliches hatten, fuhren die Jungs mit Drachen und Schiffen auf. Du warst toll. Ich durfte beim Lehrer die Pläne holen und dann sassen wir zusammen hin und bauten alles nach. Ich habe es geliebt. Klar hätte ich gerne selbst gebaut, aber du sägtest und hämmertest mehrheitlich, ich lieferte das Material. Es sollte schliesslich exakt werden. Das war dir wichtig. Dass die Dinge richtig waren. Kein Pfusch. Nicht windschief. Immerhin lernte ich da, wie man mit Werkzeug umgeht. Und was wofür ist. Ich schaute dir zu und sog es auf.
Als ich viel später auszog, hast du mir einen Werkzeugkoffer mit auf den Weg ins Erwachsenenleben gegeben. Da war alles drin, was ich deiner Meinung nach für ein Leben allein in der grossen weiten Welt brauchte. Ich habe sie all die Jahre in Ehren gehalten, es gibt sie noch heute. Und immer, wenn ich sie anschaue, denke ich an dich und bin dankbar, dass ich immer selbst Hand anlegen konnte, wenn Not am Mann war.
Das ist mir wichtig. Dinge selbst machen zu können. Selbstständig zu sein, nicht angewiesen oder abhängig von der Hilfe anderer. Du hast immer gesagt:
«Mach die Dinge selbst, dann weisst du, dass sie richtig gemacht sind.»
Oder auch:
«Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner.»
Diese beiden Sätze haben mich mein Leben lang begleitet. Und sie haben sich oft bewahrheitet. Vielleicht habe ich mir auch ab und zu das Leben schwer gemacht, weil ich immer dachte, alles allein schaffen zu müssen. Aber immerhin habe ich es geschafft. Meistens. Und manchmal kam plötzlich von irgendwo Hilfe, wenn gar nichts mehr ging. Vielleicht hätte ich doch mehr darauf vertrauen können oder sollen.
(«Alles aus Liebe», XIX)