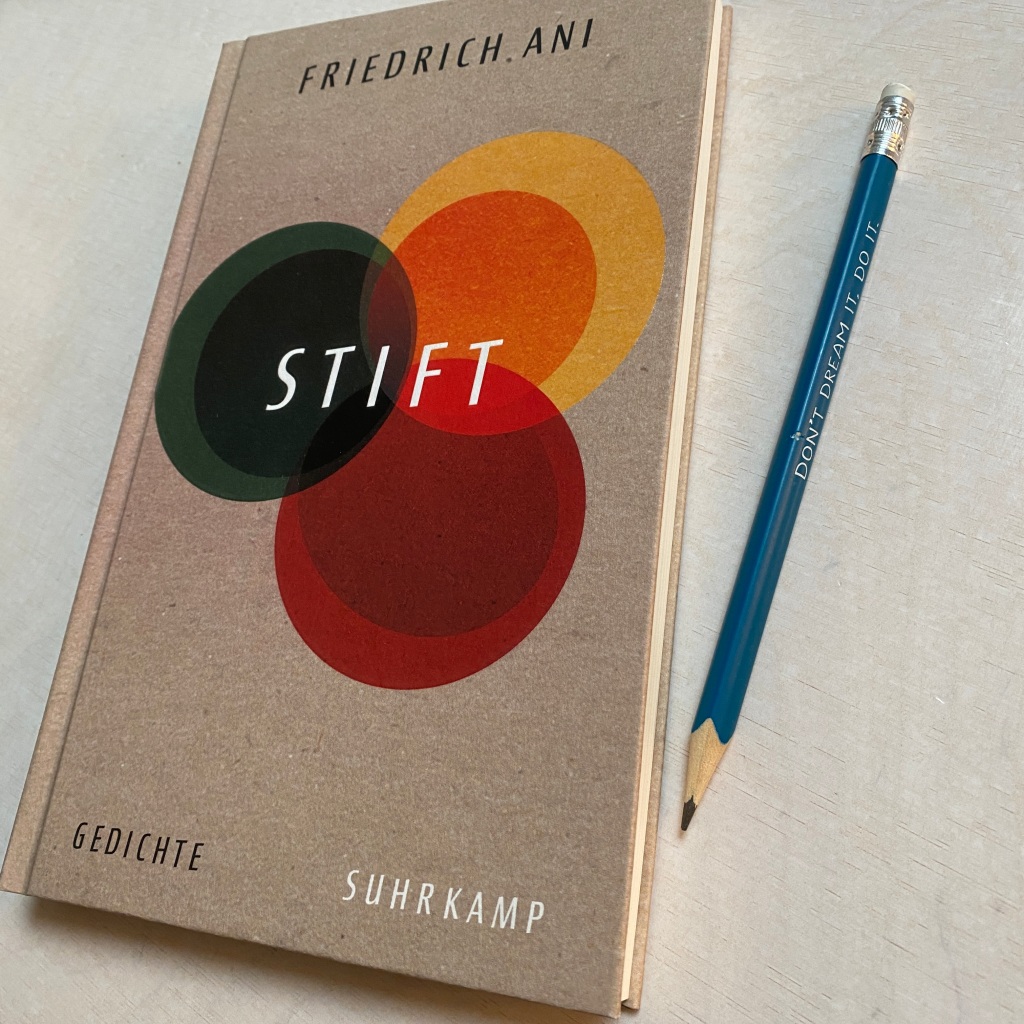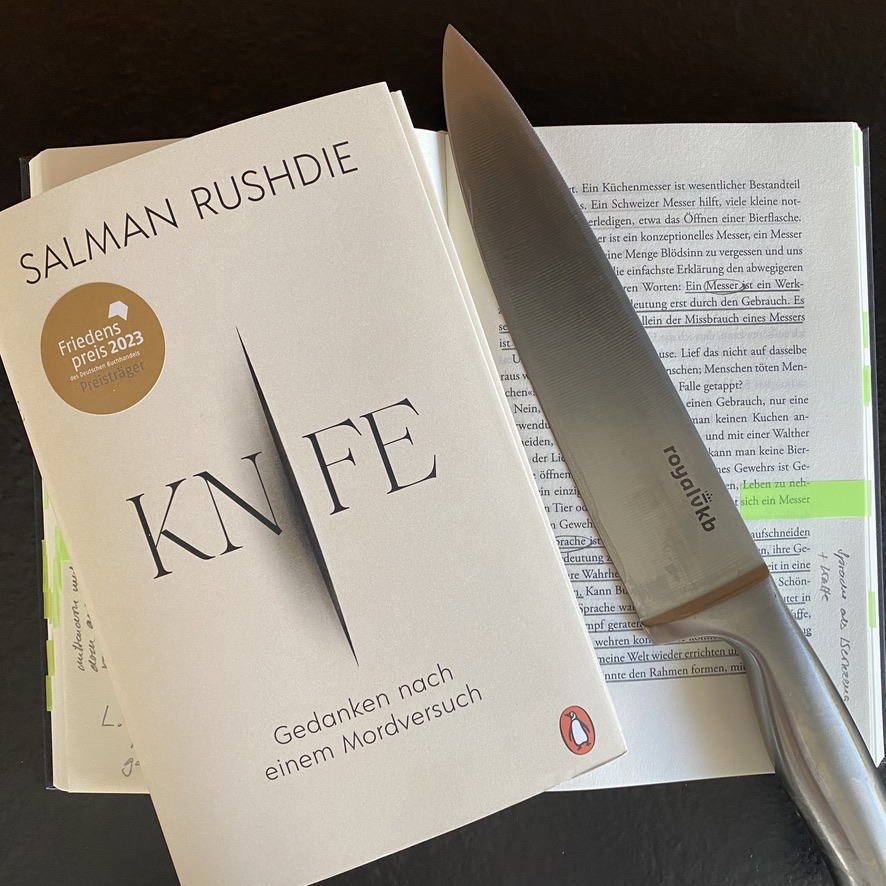«Gravierender… ich lebe in meinem Schreiben – es verschlingt meine Gedanken. Ich habe jede Menge Ideen, Pläne, alles auf einmal – in jeder freien Sekunde denke ich darüber nach, tüftle, revidiere, ohne aber das, woran ich im Augenblick arbeite, aus dem Blick zu verlieren…»
Paul Auster ist ein Schreibender. Er ist einer, der sich und sein Leben förmlich dem Schreiben verschrieben hat – und der Liebe. Doch die kommt erst später. Zuerst muss er zu dem heranwachsen, der er mal sein wird. Er muss eine Kindheit durchleben, die ihn zu dem macht oder aus der er das macht, was er als sein Leben bezeichnet. In diesem Buch beschreibt Paul Auster diese Kindheit und sein Heranwachsen. Er beleuchtet das, was er aus Erinnerungen und Erzählungen kennt und analysiert es mit seinem erwachsenen Blick. Er durchläuft all die Jahre vom Kind bis hin zum frühen Erwachsenen. Den letzten Teil dieser Erinnerungen bilden Briefe, die er seiner langjährigen Freundin und ersten Ehefrau Lydia Davis geschrieben hatte. Abgerundet wird das sehr persönliche Buch durch Einblicke in das familiäre Fotoalbum.
«…dies ist der Moment, in dem wir die Fähigkeit erwerben, uns selbst unsere Geschichten zu erzählen, die ununterbrochene Erzählung zu beginnen, die erst mit unserem Tod endet.»
Wann ist der Mensch so weit, dass er sich seines eigenen Seins bewusst ist? Wann erkennt er sich als Denkenden und Handelnden? Nach Paul Auster tritt ein Kind im Alter von sechs Jahren in diese neue Phase des Lebens. In diesem Alter, so Auster, denkt ein Kind und weiss, dass es etwas denkt. Es fängt an, sich dieses Denken und sein Leben zu erzählen. Das erinnert mich an Max Frisch, der in «Mein Name sei Gantenbein» schrieb:
«Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält…»
Beim Blick auf die Kindheit spielen die Eltern eine grosse Rolle. Sie sind es, die das nächste Umfeld bilden, die Beziehung zu ihnen legt den Grundstein unseres Seins. Paul Austers Blick zurück ist kein verklärender. Es ist ein offener und schonungsloser. Er legt dafür den Finger in seine Wunden und zeigt, wie sie entstanden sind.
«…die beiden haben es verpfuscht, und dass du diese Katastrophe als Kind miterleben musstest, hat dich zweifellos nach innen getrieben und einen Mann aus dir werden lassen, der den grössten Teil seines Lebens allein in seinem Zimmer verbracht hat.»
In einem Interview sagte Paul Auster, jeder Schriftsteller sei ein Verwundeter, ein glücklicher Mensch würde kaum jeden Tag in ein einsames Zimmer sitzen und schreiben. Der Schriftsteller gehe in die Kunst, in sein Schreiben, weil das der Ausdruck seiner Wunde sei.
«…dort hast du dir beigebracht, allein sein zu können, und nur wenn ein Mensch allein ist, kann er seinen Gedanken freien Lauf lassen.»
Es gibt zwei Sichten, das eigene Sein zu sehen: Man wurde, wer man ist, weil die Dinge waren, wie sie waren, oder man wurde es, obwohl sie so waren. Die schwierigen Familienverhältnisse waren belastend für den kleinen Jungen und dieses Belastende hat lange nachgehallt. Was er aber daraus gelernt hat ist, sich zurückzuziehen in seine eigene Welt. Das war die Welt, die sich in seinem Kopf zeigte, in seinen Fantasien. Beim Alleinsein konnte er diese Welten entstehen lassen und ausmalen. Etwas, womit er nie mehr aufgehört hat – zum Glück für seine Leser. Auch wenn es nicht immer nur einfach floss:
«Das alles klingt, als sei ich… sehr beschäftigt. Vielleicht bin ich das, aber es fühlt sich für mich nicht so an. Die meiste Zeit verbringe ich völlig allein – in äusserster und furchtbarer Einsamkeit. In meinem kleinen kalten Zimmer, wo ich entweder arbeite oder auf und ab gehe oder vor Niedergeschlagenheit gelähmt nichts tue.»
So erfolgreich Paul Auster auch war, die Unsicherheit dem eigenen Schreiben gegenüber ging nie ganz verloren. Nach jedem beendeten Buch fing sie von neuem an: Würde es nochmals gelingen? Es gelang!
«…und mag es viele Dinge geben, an die du dich erinnerst, so gibt es mehr, tausendmal mehr, auf die das nicht zutrifft.»
Was erinnern wir? Was vergessen wir? Schlussendlich ist das, was bleibt, wohl ein kleiner Teil all dessen, was war. Es ist der Teil, der sich in uns festgesetzt hat, weil wir ihm zum Zeitpunkt des Erlebens einen Wert beigemessen haben und ihn darum irgendwo bewahrt haben – oft auch im Unterbewusstsein, von wo er erst wieder auftaucht, wenn es einen Auslöser dafür gibt.
Als Schlusssatz kann ich eigentlich nur noch ein Zitat anhängen:
«Am Ende glaube ich mehr als alles andere, das Einzige, was überhaupt etwas zählt, ist die Liebe.»
Die hat er gefunden und lebte mit ihr für viele Jahre. Die Liebeserklärung, die man im «Winterjournal» lesen kann, ist wundervoll. So möchte man lieben können, so möchte man geliebt werden.