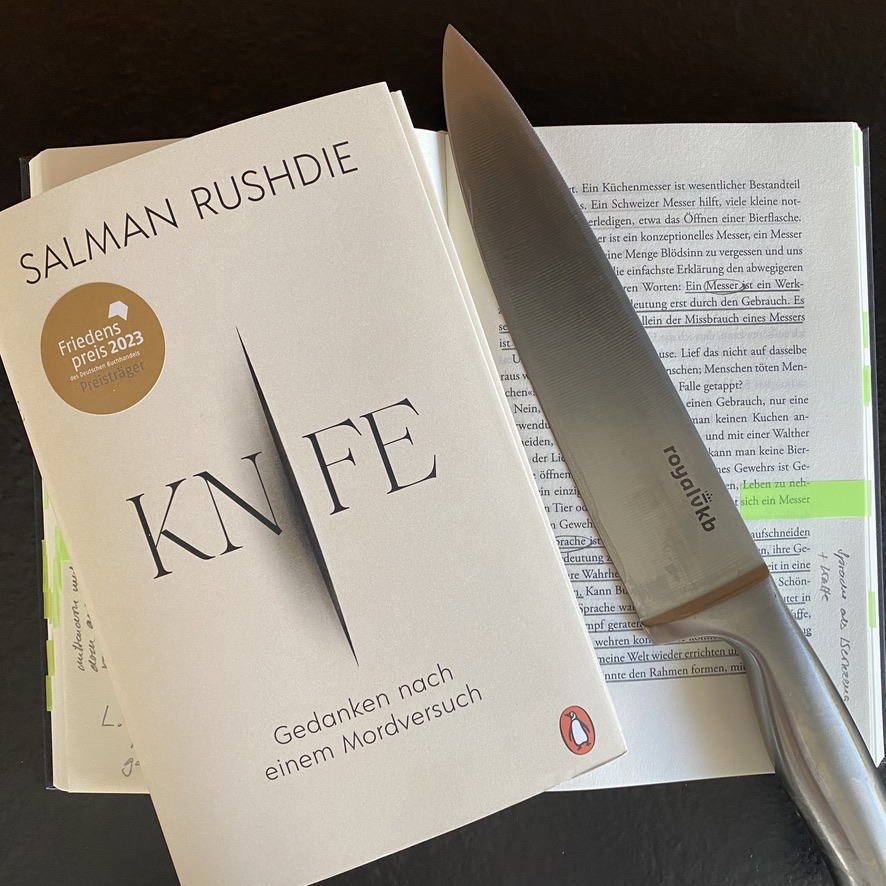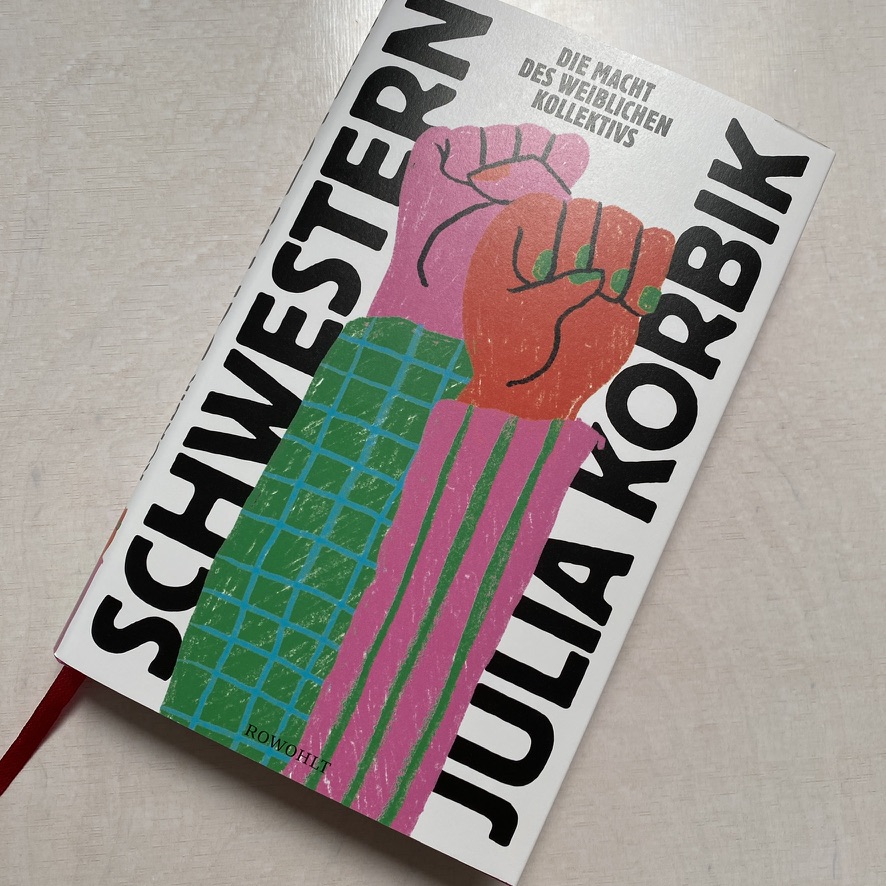Papa Kiyak hat Krebs. Die Tochter kümmert sich. Sie spricht mit den Ärzten, kocht Essen, will für ihn da sein, redet gut zu und hat selbst keine Kraft. Sie weint plötzlich in den unmöglichsten Situationen, kämpft immer wieder an allen Fronten, wütet über die Bedingungen von Migranten und denen in Spitälern. Und zwischendurch lässt sie sich von ihrem Papa Geschichten erzählen. Von früher. Von der Familie.
«Zum ersten Mal denke ich, dass mein Vater es nicht packen wird.»
Als ich das Zitat gelesen habe, erkannte ich mich wieder. Genau so war das. So kenne ich es. Eine sachliche Rezension zu diesem Buch zu schreiben, ist mir unmöglich. Oder: Ich will es nicht.
Ich wollte das Buch beim Lesen so oft abbrechen. Es tat mir nicht gut. Es warf mich zurück. Zu den gleichen Sätzen, die ich vor einigen Jahren auch hörte. Zu den Kämpfen, obwohl ich tief drin die Hoffnung aufgegeben hatte – und doch weiter hoffte. Es versuchte. Zurück zum Weinen in Trams, in Einkaufszentren. Zurück zu Zusammenbrüchen, tiefer Trauer. Angst.
Mely Kiyak schreibt über sich und ihren Vater. Sie schreibt über dessen Krebs und wie er sich ausbreitete. Lunge. Nieren. Leber. All das hatte ich genauso. Und so vieles dazu. Wie will ich da einen sachlichen Text darüber schreiben? Ich habe geweint. Nein. Geheult beim Lesen.
«Das scheint vollkommen üblich zu sein. Dass man sterbenskranken Menschen ihr Essen nicht dann gibt, wenn sie es brauchen und wollen, sondern dann, wenn es dem System in den Kram passt.»
Natürlich war das Verständnis für das Personal bei mir da. Sie sind alle überlastet. Und doch lag da mein Vater. Als ich all die Beschreibungen des Spitalalltags las, erkannte ich alles wieder. Mehr noch, ich war wieder drin. In dieser Wut, diesem Ausgeliefertsein. Ja, wir hatten teilweise grossartige Pflegekräfte. Geduldige Ärzte. Aber auch das Gegenteil. Und in all dem liegt dein Vater. Der Mensch, der dir so viel beigebracht hat. Der dir so wichtig, so lebenswichtig, wie du dachtest, ist. Unerträglich. Und doch muss es ertragen werden. So ging es mir wieder beim Lesen. Ich konnte nicht aufhören. Obwohl ich es kaum ertragen habe. Was für das Buch spricht. Es ist ehrlich. Es ist schonungslos. Es ist persönlich. Es ist authentisch.
«Noch bevor ich sprechen kann, fange ich an zu weinen. Es ist mächtiger als ich. Ich habe mich nicht im Griff. Dabei beginnen wir erst.
Was soll ich schreiben: So war das. Die Direktheit von Mely Kiyaks Schreiben führt es mir nicht nochmals vor, sie wirft mich nochmals rein. Und in all das, was als nette Beigabe in solchen Situationen dazukommt: Die Isolation, das Abwenden von Freunden, weil man keine Zeit mehr hat. Weil man sich ja kümmern muss. Und danach keine Worte findet auf die Fragen, die kämen.
«Man gewöhnt sich an Menschen, liebt sie, und am Horizont winkt bereits der Tod. Man fragt sich doch, worin der Sinn des Lebens besteht, wenn am Ende gestorben wird.»
Ja, wo liegt der Sinn des Lebens? Worauf kann man bauen? Es ist das elende Gefühl, das Mascha Kaléko beschreibt, dass der eigene Tod kein Schrecken ist, aber der derer, die man liebt. Alle können einem immer genommen werden.
Fazit zum Buch
Berührend. Bewegend. Tief.
(Mely Kiyak: Herr Kiyak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an, Carl Hanser Verlag GmbH, München 2024.)