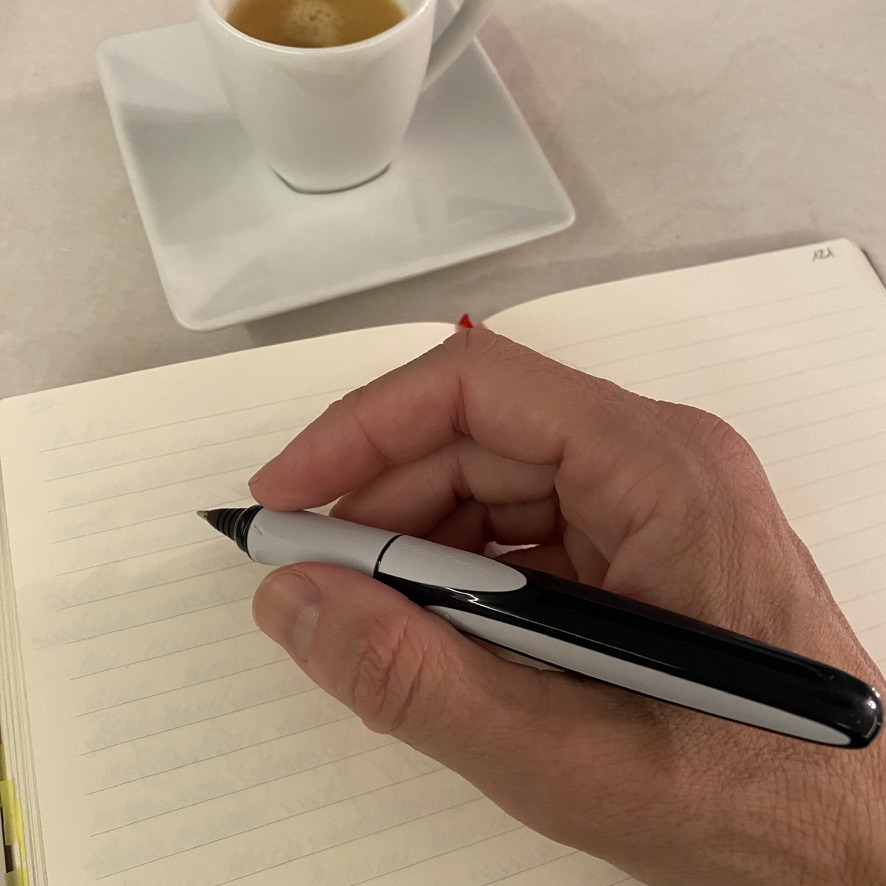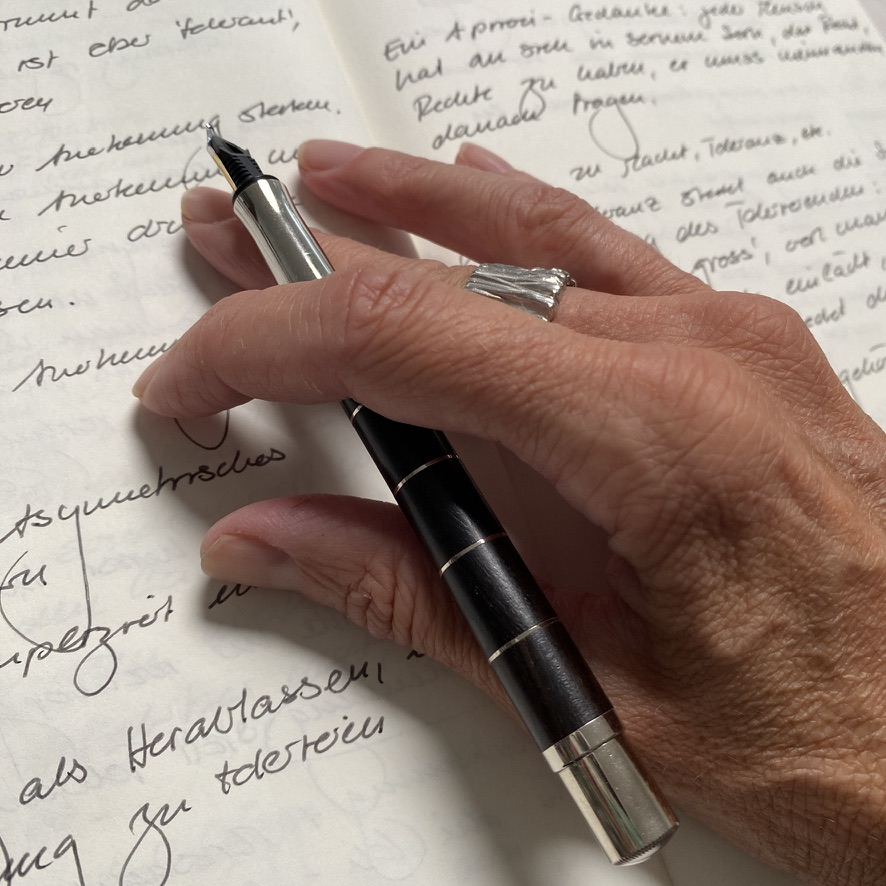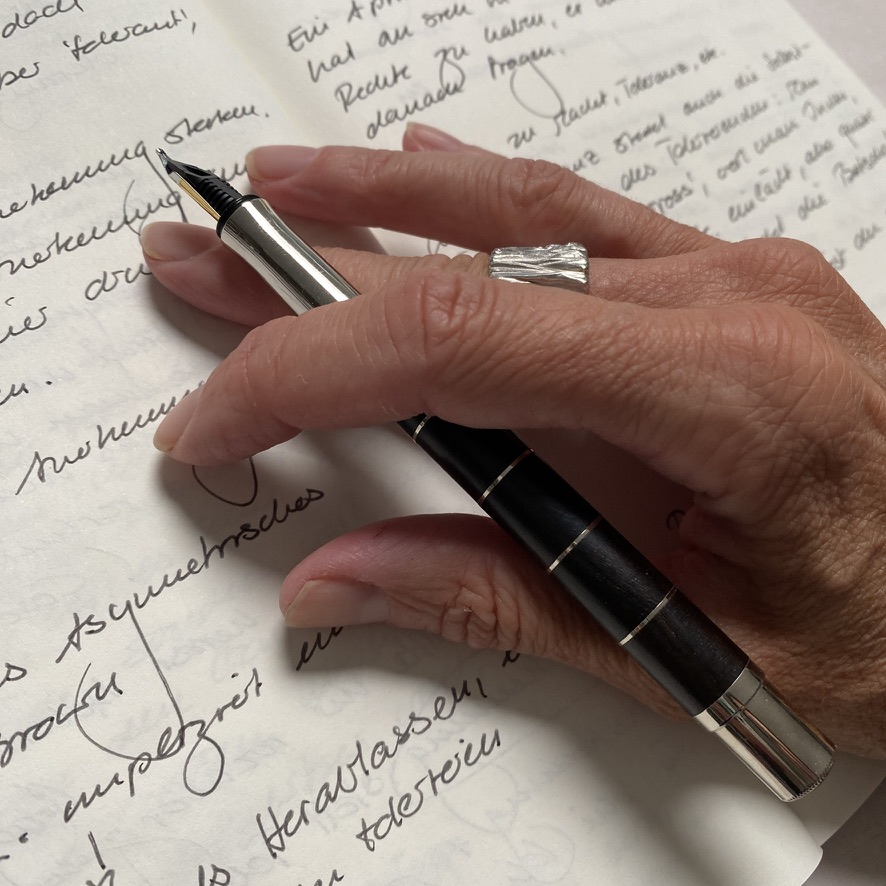Lieber Papa
Kürzlich hatte ich einen Traum. Ich fand nicht mehr nach Hause. Ich lief durch die Strassen, kam zu der Stelle, wo unser Haus immer gestanden hatte, aber es sah völlig anders aus. Ich ging hinein. Auch drinnen war alles verändert. Und doch schien ich überzeugt, hier zu wohnen. Ich klingelte. Keiner öffnete. Alles war stumm. Ich zweifelte, ob ich nicht doch am falschen Ort sei. Nur: Wo wäre der richtige? Ich hatte keine Ahnung. Ich fühlte mich verloren.
Ich habe diesen Traum schon oft geträumt. Es ist immer alles gleich. Während ich dir von diesem Traum schreibe, erinnere ich mich an etwas, das passiert ist, als ich etwa drei oder vier war. Erinnerst du dich an den Tag, an dem ich verschwunden bin?
Ich ging mit Mama zum Einkaufen. Vor dem Eingang des Einkaufszentrums gab es einen kleinen Bildschirm mit einer Sitzbank davor. Wenn man Geld einwarf, konnte man ein Märchen anschauen. Jedes Mal, wenn wir da waren, fragte ich, ob ich den Film schauen darf. Einkaufen fand ich langweilig. Mama sagte immer nein. Doch dieses eine Mal stimmte sie zu. Freudig setzte ich mich hin und war schon bald völlig in den Film vertieft. Ich bin nicht sicher, aber manchmal bilde ich mir ein, ich sähe noch die Bilder vor mir und hörte die Zwerge singen, wenn sie von der Arbeit heimkehrten zu Schneewittchen.
Plötzlich sah ich aus den Augenwinkeln Mama, wie sie aus dem Gebäude ging. Hatte sie mich vergessen? Schnell sprang ich auf und lief zum Ausgang. Ich sah sie nirgends mehr. Vielleicht hatte ich mich getäuscht. Ich setzte mich wieder hin und schaute weiter, konnte mich aber nicht mehr auf den Film konzentrieren. Immer wieder schaute ich zum Ausgang, befürchtete, ich könnte Mama verpassen. Doch sie kam nicht. Vielleicht hatte ich mich vorher gar nicht getäuscht, vielleicht war sie tatsächlich nach Hause gegangen und hatte mich hier vergessen.
Ich konnte es kaum glauben, dass sie mich einfach vergessen konnte. Sie musste noch irgendwo sein. Ich wollte sie suchen. Ich lief durch das ganze Einkaufszentrum, lief in alle Läden, die ich kannte: Die Tierhandlung mit den Fischen, Vögeln und den Meerschweinchen, die ich immer streicheln wollte, die Drogerie, in welcher wir dieses grässliche Biomalt kauften, das ich jeden Morgen schlucken musste, die chemische Reinigung, den Kiosk, wo sie manchmal den Lottoschein ausfüllte, das Café ganz hinten im Einkaufszentrum, auch wenn wir da noch nie drin gewesen waren. Nichts. Ich lief zum hinteren Ausgang hinaus, lief um das Einkaufszentrum herum und landete wieder beim vorderen Eingang. Nirgends sah ich sie.
Zum Glück bin ich schon oft mit Mama zum Einkaufszentrum gelaufen, so dass ich den Weg gut kannte. Ich beschloss, allein nach Hause zu gehen, vielleicht konnte ich sie noch einholen.
Zuerst musste ich eine grosse Strasse überqueren, danach führte mein Weg eine Wiese entlang, in deren Mitte ein Bauernhof stand. Ab und zu grasten Ziegen und Schafe auf der Wiese, die ich zu streicheln versuchte. Dafür hatte ich nun keine Zeit. Auf der anderen Seite des Weges war ein kleines Mäuerchen, auf dem ich gerne balancierte, auch wenn Mama das nicht mochte. Heute fehlte mir der Sinn dafür. Ich fühlte mich allein und traurig, und ja, ich hatte Angst. Ich fürchtete, dass ich etwas falsch gemacht hatte, dass Mama mit mir schimpfen würde. Ich hatte Angst, dass sie es dir erzählt und du mich mit dem Blick anschauen würdest, der sagte: «Wieso kannst du nicht mal normal sein, wieso musst du dich immer danebenbenehmen?»
Als nächstes musste ich wieder eine grosse Strasse überqueren. Zum Glück kamen nicht viele Autos, aber so allein wirkte sie doch bedrohlicher, als wenn ich mit Mama unterwegs war. Zum Glück wurde es nun einfacher. Ich musste nur noch einer Strasse folgen, die zwar ein paar Kurven machte, dann aber zu unserem Haus führte. Wenn ich mich richtig erinnere, traf ich auf dem ganzen Weg keinen einzigen Menschen. Nicht nur ich war allein, die ganze Welt schien verlassen zu sein. Wenn mir jemand begegnet wäre, hätte er sich gewundert, dass ein so kleines Mädchen allein unterwegs war? Hätte er mir meine Angst angesehen? Habe ich geweint? Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich weinte nicht. Während ich das schreibe, merke ich, dass ich auch schon kleine Kinder allein auf dem Trottoir sah und mich fragte, ob ich etwas tun müsste. Ich habe nie etwas gemacht. Ich hatte immer Angst, mich irgendwo einzumischen und dann Ärger zu kriegen. Eigentlich feige. Ich will das ändern.
Endlich kam ich bei unserem Haus an. Ich wollte klingeln. Ich konnte zwar nicht lesen, aber ich wusste genau, welches unser Schild war. Ich frage mich, wieso ich es wusste. Habt ihr es mir gezeigt? Wieso hättet ihr das tun sollen? Zu dem Zeitpunkt war ich noch nie allein draussen gewesen. Auch war ich nie mit anderen unterwegs, die hätten klingeln müssen. Ich weiss es nicht, aber es ist unwichtig. Das Schild hing zu hoch. Ich kam nicht ran. Da stand ich nun und wusste nicht, was tun. Meine Angst wurde grösser. Ich war hier allein und ihr schient unerreichbar.
In dem Moment kam unsere Nachbarin, Frau Vogelmeier, aus dem Haus. Sie bückte sich zu mir runter. «Was machst du hier? Wo ist deine Mama?» Ich glaube, da begann ich zu weinen. Ich erzählte ihr von Schneewittchen und von Mama, die mich vergessen hatte. Ich erzählte ihr von meiner Suche und dem Heimweg, erzählte von der Klingel, die zu hoch hing. Frau Vogelmeier tröstete mich: «Deine Mama hat dich bestimmt nicht vergessen, sie sucht dich bestimmt schon.» Sie nahm mich an der Hand und gemeinsam liefen wir zum Einkaufszentrum zurück. Ich weiss nicht mehr genau, was dann passiert ist. Alles, was ich noch weiss, habt ihr mir später erzählt. Oder weiss ich auch das bis hierhin nur aus euren Erzählungen und erzähle es mir nun selbst als meine Erinnerung? Ich bin mir nicht sicher.
Mama erzählte, dass sie aus dem Laden kam und ich verschwunden war. Du erzähltest, dass Mama dich angerufen habe. Du hättest alles stehen und liegen lassen, ein Taxi gerufen und seist zum Einkaufszentrum gefahren. Bis du kamst, lief Mama immer wieder durch das Einkaufszentrum, fragte überall nach mir. Keiner hatte mich gesehen. Nirgends war eine Spur von mir. Das alles passierte in einer Zeit, in welcher mehrere Kinder in meinem Alter verschwunden sind. Entsprechend gross war eure Sorge.
Endlich kamen Frau Vogelmeier und ich beim Einkaufszentrum an. Ich glaube, du bist zu mir runtergekniet und hast mich in den Arm genommen. War das so? Sicher bin ich nicht. Ich stelle es mir so vor. Und Mama? Was machte sie? Was fühlte ich? Das ist alles ausgelöscht.
Ich weiss nicht, wieso ich bei meinem Traum an diese Geschichte denke. Haben sie etwas miteinander zu tun? Gemeinsam ist ihnen sicher die tiefe Verlorenheit, das Gefühl, kein Zuhause zu haben, nirgends hinzugehören. Noch heute frage ich mich manchmal, was das ist: Zuhause. Oder Heimat. Ich habe nur leise Ahnungen, ich kann beides nicht ganz fassen.
(«Alles aus Liebe», VII)