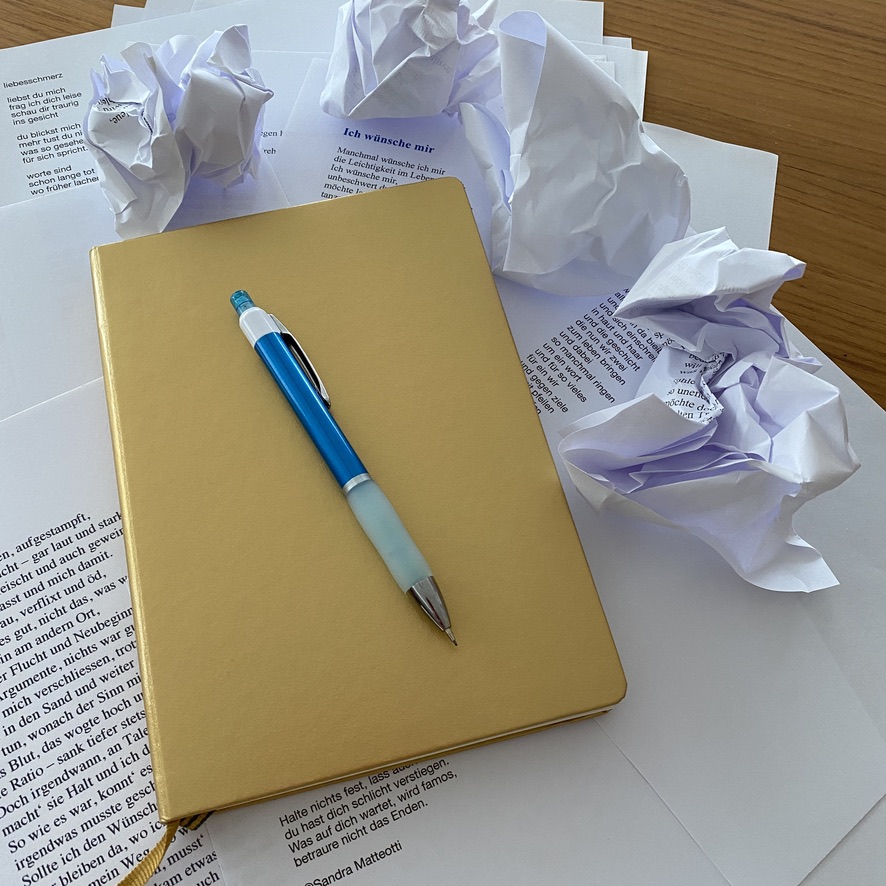Lieber Papa
Ach Papa, du warst und bist so vieles für mich. Und wenn ich hier so schreibe, merke ich, wie sich die Dinge hin und her bewegen. Mal ist es düster und ich denke, das tut dir unrecht. Dann möchte ich es fröhlicher machen, möchte das Dunkel aufklären. Und merke bald darauf, dass es nun nicht mehr stimmt. Es war nicht hell. Zumindest nicht tief drin. Und doch war da immer auch wieder Licht. Und Hoffnung. Und so viel Sehnsucht. Nach Liebe.
Als Kind warst du mein Held. Du warst der Mensch, dem ich gefallen wollte, dessen Liebe und Bestätigung ich so sehr suchte. Und brauchte. Du warst der Mensch, zu dem ich ging, wenn meine Welt ins Wanken geriet. Warst der Mensch, von dem ich glaubte, er könne mir immer helfen. Egal wobei. Auf dich konnte ich bauen. Daran glaubte ich. Das war auch so. Manchmal musste ich zuerst durch eine Standpauke hindurch. Die schmerzte. Sie brachte mich ins Wanken. Mein Bild von mir. Doch dann halfst du. Und ich war froh. War ich doch so klein. Du so gross. Und stark. Und da für mich. Du wolltest mich immer beschützen. Vor allem. Daran glaube ich ganz fest.
Es gab aber Situationen, in denen du nichts machen konntest. Weil du keine Ahnung hattest. Weil ich dir nichts erzählt habe. Wieso eigentlich? Vielleicht, weil ich fürchtete, du würdest mich dann verachten. Du würdest mich für einen Schwächling halten und als solcher wollte ich nicht vor dir stehen. Du solltest stolz sein auf mich. Du solltest keine Tochter haben, die gehänselt und geplagt wird. Keine, die man nicht mag, wo man doch dich überall mochte. Ich wollte sein wie du.
Da war dieses Mädchen in der Schule. Sie war nicht in meiner Klasse. Ich weiss nicht mal, woher ich sie kannte – oder sie mich. Ich weiss auch nicht, wieso sie mich nicht mochte. Gab es vor diesem einen schlimmen Vorfall andere? War die Angst schon lange mein Begleiter? Geschah das alles gar nicht aus dem Nichts? Während ich diese Fragen schreibe, sagt eine leise Stimme in mir:
„Das muss so gewesen sein. Aus dem Nichts wäre das nie passiert. Nicht in dieser Heftigkeit.“
Doch so sehr ich mich auch anstrenge: ich kann mich an nichts Konkretes erinnern. Ich sehe sie nicht mal mehr vor mir. Ich habe keine Ahnung, wie sie ausgesehen hat. Ich weiss nur noch, dass sie Linda hiess. Interessant, wie mir immer wieder Namen von damals in den Sinn kommen. Eigentlich habe ich ein sehr schlechtes Namensgedächtnis.
Wenn ich an diesen einen Tag denke, ist da nichts. Nichts vorher. Nichts nachher. Nur das, welches die Grenze bedeutete zwischen beiden. Ich erinnere mich auch nicht, ob andere Kinder da waren. Hatte sie Hilfe? Kinder, die sie anfeuerten? War ich allein? Wurde ich alleingelassen?
Ich vermute, ich sah sie von weitem. Sie kam auf mich zu. Ich vermute, sie hat mir etwas zugerufen. Etwas Abschätziges. Gemeines. Bin ich weggelaufen? Es muss so sein. Unser Schulplatz war ein grosser grauer Betonplatz mit einem überdachten Gang rundherum. In regelmässigen Abständen wurde dieser Gang durch Wände zu einem kurzen Tunnel gemacht. Keine zwei Meter breit war einer. In einem solchen Durchgang passierte es. Ich war etwa 10. Linda zwei Klassen über mir. Ich weiss nicht, wieso ich das weiss, aber so war es. Sonst weiss ich nichts. Nicht, wo sie wohnte, nicht, wer ihre Eltern waren, ob sie Geschwister hatte, wer ihre Freunde waren. Während ich das tippe, fällt mir ein, dass sie Anführerin einer Gruppe war. Wofür die stand, wer dazu gehörte – keine Ahnung. Das ist aber auch nicht wichtig für das, was ich erzählen möchte.
Alles, was ich noch genau weiss, ist, dass sie mich so grob an die Wand stiess, dass mein Kopf mit Wucht dagegen knallte. Dem Aufprall folgte ein lauter Knall in meinem Kopf. Er drohte zu platzen. Es fühlte sich an, als ob in meinem Hirn etwas geplatzt sei, woraufhin ein heisser Schmerz wie warmes Blut im Kopf herabfloss und ihn bald ganz ausfüllte. Ich ging zu Boden. Ich weiss nicht, wie lange ich da liegen blieb. Ich weiss, dass ich noch einen Tritt in den Rücken kriegte. Danach ist alle Erinnerung weg. Kam da jemand? Stand ich allein wieder auf? Ging ich ins Klassenzimmer zurück, als ob nichts gewesen sei? Und dann später nach Hause, wo ich weiter schwieg?
Ich habe nie jemandem von dieser Geschichte erzählt. Die Scham war zu gross. Ich schämte mich, das Kind zu sein, das man einfach angreifen konnte. Angreifen wollte. Der Trottel vom Pausenplatz. Die Versagerin. Die Unterlegene. Als solcher Schwächling konnte ich niemandem unter die Augen treten. Ich konnte nur hoffen, dass es niemand mitkriegte. Wobei da tief in mir die Stimme war, die sagte:
„Das wissen es eh alle. Alle sehen dich als Versager. Alle finden dich komisch.“
Wieso dachte ich das? Ich weiss es nicht. Vielleicht habe ich es zu oft gehört. In all den Situationen, in denen ich nicht war, wie man hätte sein sollen. Immer dann, wenn es hiess, ich müsse mich ändern, sonst wolle keiner etwas mit mir zu tun haben. Aber das konnte ich nicht. Und zahlte wohl so den Preis dafür. Dachte ich.
Was sonst an diesem Tag noch passiert ist, weiss ich nicht mehr. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist dieser Knall und dieses Platzen im Kopf. Ich glaube, in dem Moment ist in mir auch sonst so einiges geplatzt. Vielleicht auch die Hoffnung, irgendwann irgendwo wirklich dazugehören zu können.
(„Alles aus Liebe“, XXVII)