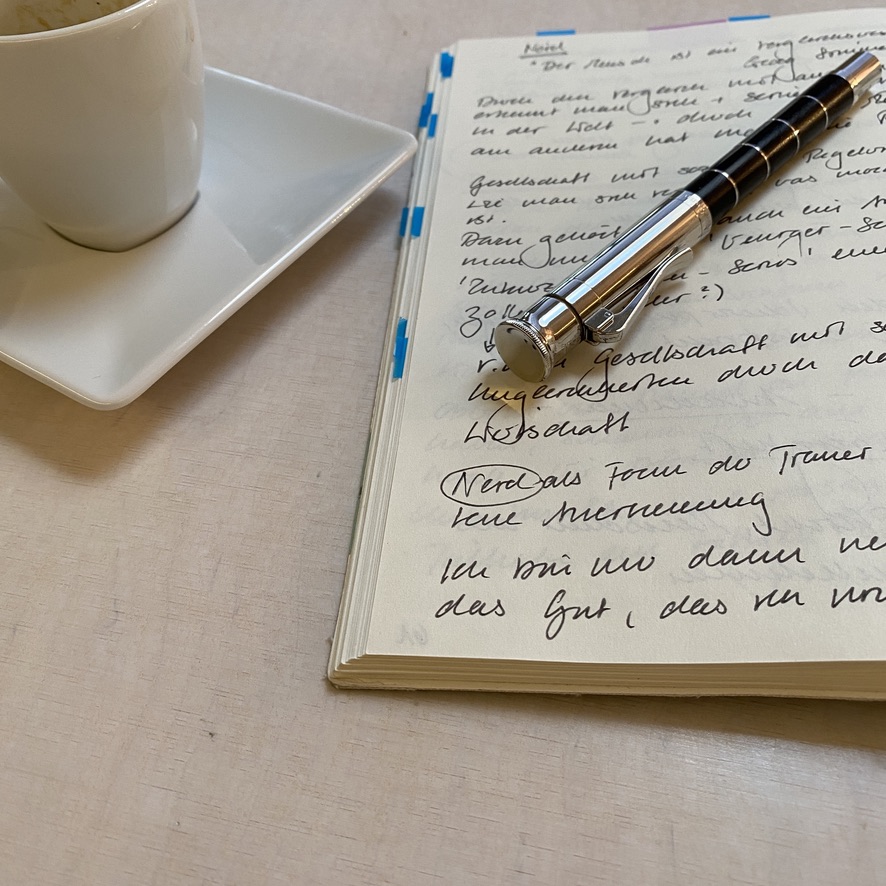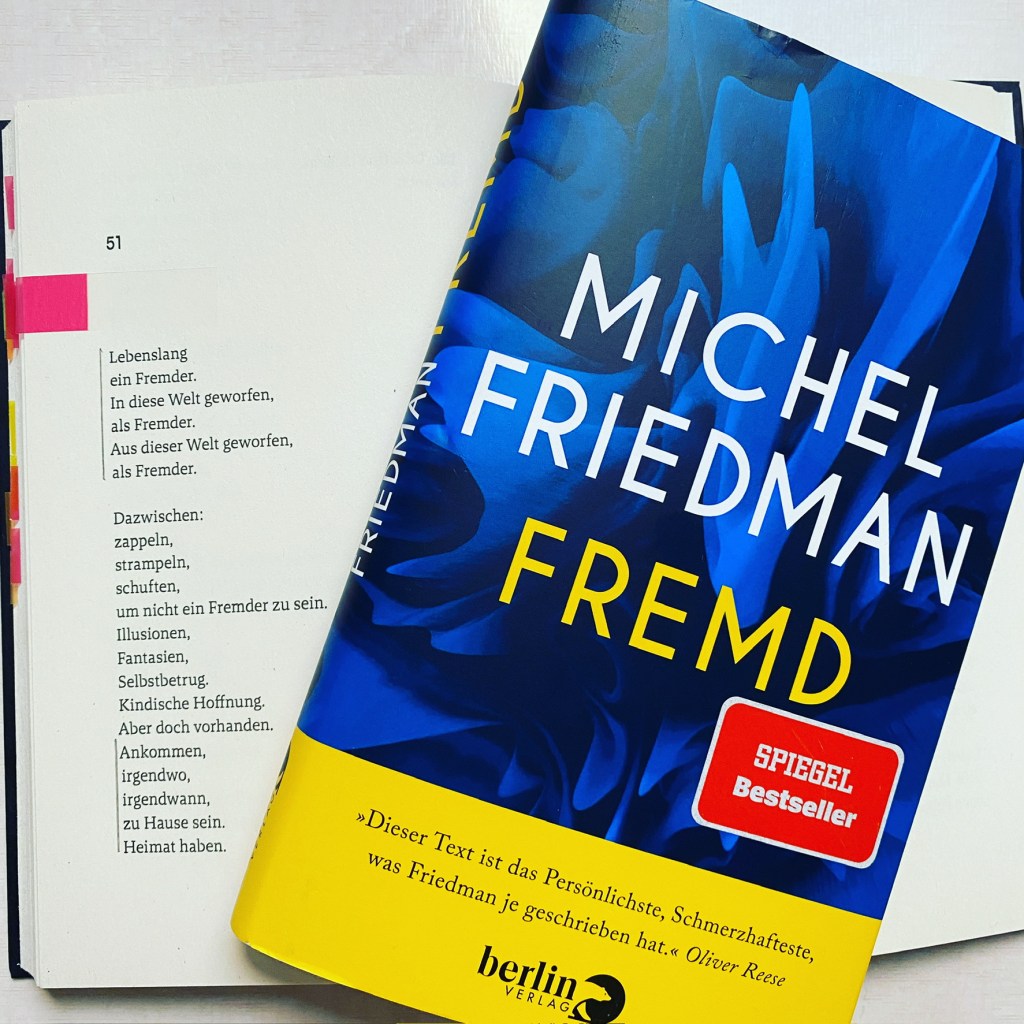Inhalt
„Wir befinden uns in einer Art Limbus, einer verwaschenen Zwischenwelt ohne erkennbaren Horizont: die Zwillinge zwischen Kindheit und Erwachsenwerden, ich zwischen erwachsen und alt, alle zwischen dieser Familienwohnung und unseren neuen Lebenssituationen.“
Eine alleinerziehende Schriftstellerin mit Zwillingen, die bald ausziehen, erinnert sich an ihr Leben. Sie erinnert sich in kleinen Episoden an Begebenheiten aus ihrer Kindheit, aus der Jugend, aus dem Leben danach. Sie denkt an verflossene Beziehungen, an ihre Geschwister und an ihre Eltern, denkt an die Rolle, die sie in all diesen Beziehungen spielte. Sie ist sich nie ganz sicher, was davon wirklich erinnert und was vergessen und neu erfunden ist. Und manches ist wirklich vergessen. Doch irgendwie ist das nicht wichtig.
Es ist eine Zeit des Umbruchs: Die Kinder ziehen aus, ein neuer Abschnitt, ihr Leben allein beginnt – nur wo soll dieses stattfinden?
Gedanken zum Buch
„Wenn wir erst mal Kinder haben, sind wir Frauen in den Augen der anderen nichts mehr ohne sie.“
In unserem Leben übernehmen wir viele Rollen. Wir sind Kinder, Freunde, Partner, Arbeitende, Sportler, Mütter. All diese Rollen sind prägend, sie prägen unser Bild von uns selbst und unser Verhalten, aber sie prägen auch das Bild nach aussen, das die anderen von uns haben. Fälle eine dieser Rollen weg, gerät unser Selbstbild ins Wanken. Die Frage, was von uns bleibt, nach innen und nach aussen, steht im Raum. An diesem Punkt steht die Protagonistin, die sich fragt, was es für sie bedeutet, wenn ihre Kinder ausziehen.
Es bleibt nicht aus, an dem Punkt auch das eigene Muttersein zu überdenken, hinzuschauen, wie sie diese Rolle ausgefüllt hat. Sie tut dies auf eine offene, selbstkritische Weise, sieht, wo ihr die Rolle auch schwer fiel, wo sie (eigenen oder fremden) Idealvorstellungen nicht genügt hat. Es gilt aber auch, sich neu zu besinnen, zu sehen, was nun kommt, was das Wegfallen der Rolle für das eigene Leben nun bedeutet, was es nach sich zieht. Vordergründig präsent ist die Wohnung. Wo sie ist, kann sie nicht bleiben, die Frage, wo sie hin soll, stellt sich schwierig dar (zumindest für die Protagonistin, die Leserin hat wohl schon lange eine Idee).
„Mein Problem ist lächerlich. Es ist nur eine behagliche Wohnung, die ich gegen eine andere, vermutlich ebenso behagliche Wohnung eintauschen muss. Aber an keinem anderen Ort habe ich länger gewohnt als hier. “
In dieser Suche nach dem richtigen Raum für sich zeigt sich die Wichtigkeit, die Raum auf das Leben von Menschen hat. Im eigenen Raum spielt es sich ab, er prägt das Leben, er beinhaltet es, er schützt es auch. Der Raum trägt die Erinnerungen in sich, er zeugt von dem, was war und bietet auch Möglichkeiten, was sein könnte. Das macht die Entscheidung für einen neuen Raum oft schwer – es hängt ein Leben dran.
„Ich wollte darüber schreiben, dass ich ein schwieriges Kind war, das Probleme hatte, aber es gelang mir nicht. Was ich schrieb, sagte nicht die Wahrheit über mich, es malte ein völlig falsches Bild von meiner Familie.“
Doris Knecht hat die Geschichte einer Frau an einem Umbruch ihres Lebens geschrieben. Oft sind es diese Situationen, die dazu anregen, uns zu erinnern, zurückzublicken, um zu sehen, wie wir an diesen Ort kamen, an dem wir nun stehen. Erinnerungen tauchen auf, die wir uns erzählen und merken, dass zwar alles stimmt, und doch das entstehende Bild sich falsch anfühlt.
„Die Frau, über die ich schreibe, gibt es nicht. Sie ist ein Konstrukt, zusammengesetzt aus Erinnerungen, viele davon fehlerhaft, aus Selbstüberhöhung und Selbsthass, aus Erzählungen von anderen, aus Bildern in Fotoalben.“
Die Vergangenheit ist mehr als die Summe einzelner Teile, durch das Erinnern kommen Dinge dazu, es schleichen sich Stimmen von anderen, Bilder und das Heute mit ein und damit auch ein neuer Blick.
Von der ersten Seite an gleitet man lesend in eine Welt ein, nimmt Anteil am Leben ihrer Bewohner, erinnert sich mit, denkt und fühlt mit. Man gehört förmlich dazu, nistet sich bei diesen Menschen ein und ist zu Hause. Es ist ein warmes, ein menschliches Zuhause mit Menschen, die einem ans Herz wachsen. Es ist schwer, irgendwann wieder auftauchen zu müssen, wenn die letzte Seite gelesen und die geschriebene Geschichte zu Ende ist.
Fazit
Eine warmherzige, menschliche Geschichte über das Erinnern, das Vergessen, das Leben und die Räume, in denen es stattfindet.
Zur Autorin
Doris Knecht, geboren in Vorarlberg, ist Kolumnistin (u. a. beim Falter und den Vorarlberger Nachrichten) und Schriftstellerin. Ihr erster Roman, Gruber geht (2011), war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde fürs Kino verfilmt. Zuletzt erschienen Besser (2013), Wald (2015), Alles über Beziehungen (2017), weg (2019) und Die Nachricht (2021). Die Verfilmung von Wald kommt im Herbst 2023 in die Kinos. Sie erhielt den Literaturpreis der Stiftung Ravensburger und den Buchpreis der Wiener Wirtschaft. Doris Knecht lebt in Wien und im Waldviertel.
Angaben zum Buch
- Herausgeber : Hanser Berlin; 1. Edition (24. Juli 2023)
- Sprache : Deutsch
- Gebundene Ausgabe : 240 Seiten
- ISBN-13 : 978-3446278035