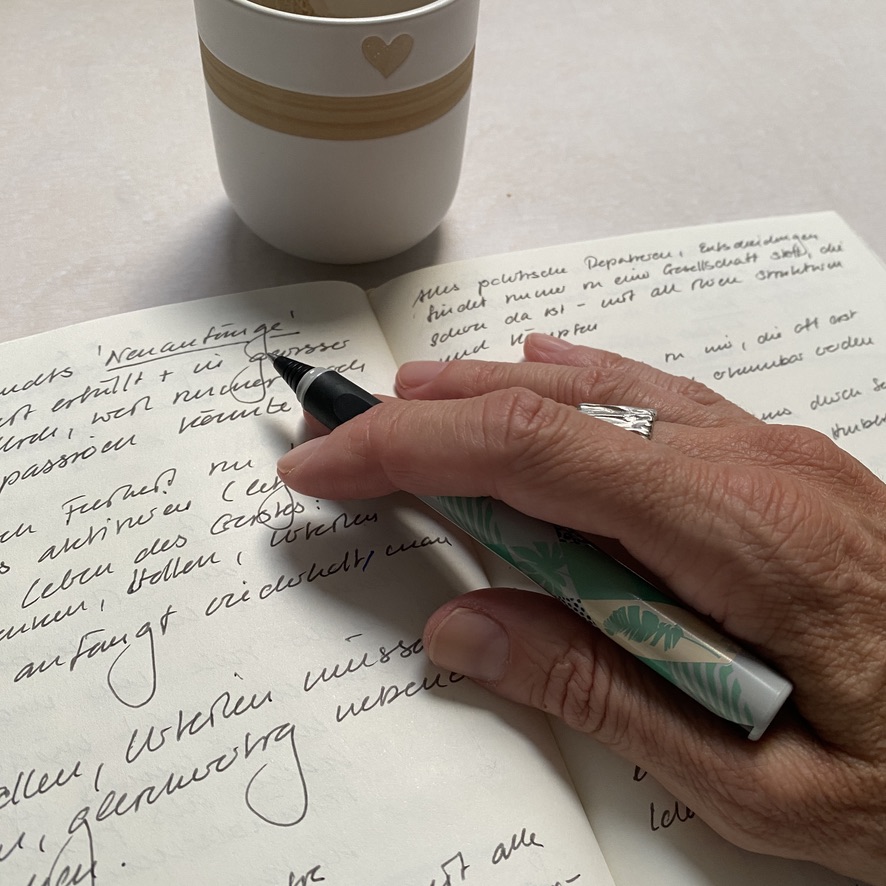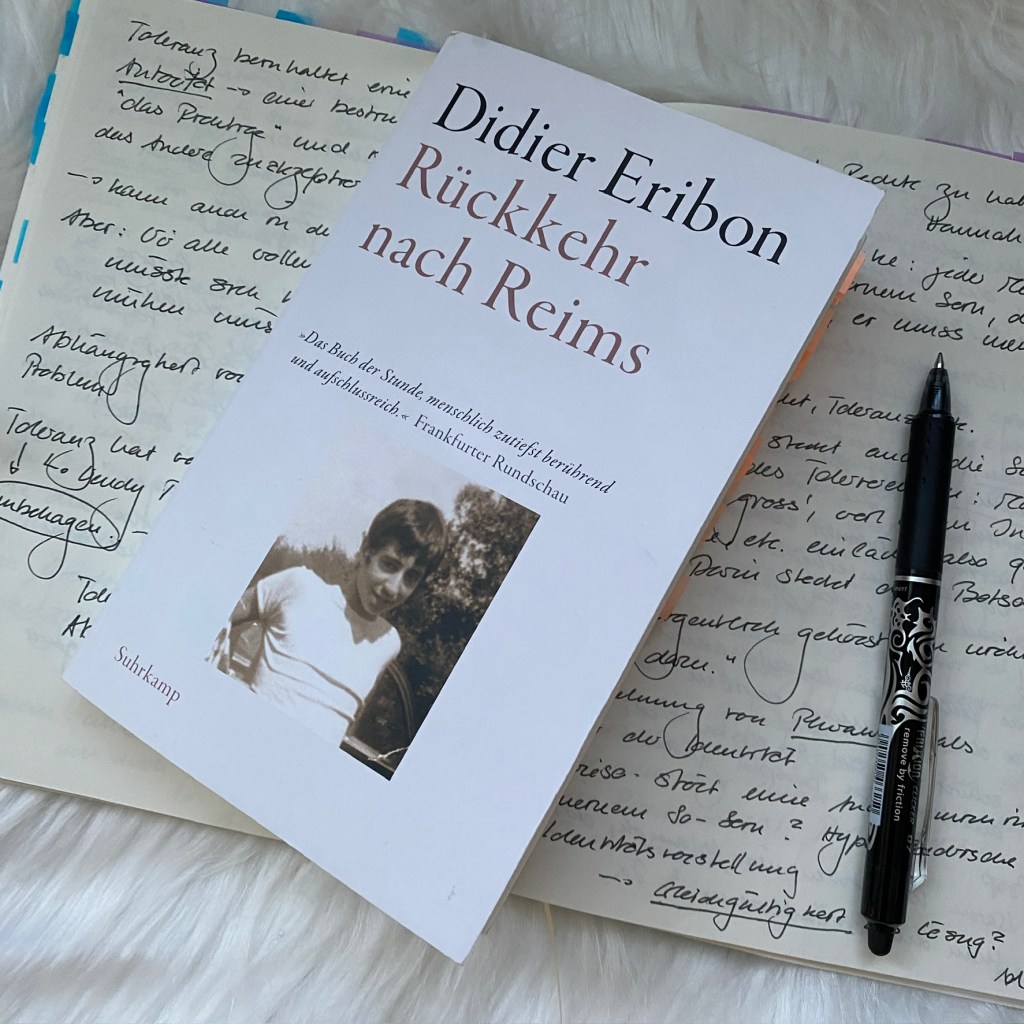«Ein wahres Zuhause ist der Ort – jeder Ort –, an dem persönliche Entwicklung stattfinden kann, und der zugleich Beständigkeit bietet.» bell hooks
Wo bin ich zu Hause, wo ist der Ort, an den ich gehöre, der Ort, an dem ich sein kann, wer ich bin, weil ich merke, dass ich es auch sein darf? Was bedeutet dieses «Sein können, wer ich bin» überhaupt und wie realisiert es sich, realisiere ich es?
Als Mensch ohne wirkliche Wurzeln, weder bei Menschen noch an Orten, war das Gefühl von Heimat oder Zuhause für mich immer ein fremdes, eines, das zwar einer Sehnsucht entsprach, von dem ich aber nie wusste, was es genau ist und was es in einem bewirkt. Die Begriffe und das, wofür sie standen, wurden immer grösser und aufgeladener, das Hoffen, sie irgendwann ergründen und gar fühlen zu können, immer stärker.
Es gab immer wieder Momente, in denen ich dachte, nun gefunden zu haben, angekommen zu sein. Dieses Ankommen war ein Ziel gewesen, eines, das dem Sehnen und Bangen ein Ende setzen würde, das den gefühlten Mangel begleichen könnte. Immer wieder war es zerbrochen. Das Gefühl kam irgendwann auf, dass das einzige, worauf ich mich verlassen, worauf ich bauen, wo ich eine Art Zuhause finden könnte, ich selbst sei. Dies aber nicht in einer Selbstsicherheit des mir selbst Halt-Gebens, sondern vielmehr als Abkehr von anderen und dem Verlust jeglichen Vertrauens in sie, entstand es doch aus dem Gefühl heraus, dass sowieso nichts von Dauer und alles dem Verlust ausgeliefert sei.
Auf dieser Basis war ein Zuhause-Fühlen kaum möglich, auf dieser Basis war ein Wohlgefühl im Sein illusorisch, da dieses mangelnde Vertrauen auch aus einem Vertrauen in mich selbst rührte – oder das mangelnde Vertrauen zu anderen auf mich zurückwirkte, indem ich dachte, dass es an mir läge, wenn ich mich alleine fände, keinen hätte, auf den ich bauen könnte. Und vielleicht tat es dies, aber anders als gedacht: Nicht war ich in meinem SO-Sein nicht in Ordnung und damit nicht liebenswert, sondern in meinem fehlenden Vertrauen vermittelte ich selbst eine Form von Abwehr, verschanzte ich mich selbst hinter den selbstgebauten Schutzmauern, die sich schlussendlich als Gefängnismauern entpuppten.
Es ist wohl gar nicht so falsch, dass ich schlussendlich in mir selbst zuhause sein muss, dass ich auf mich bauen und vertrauen muss. Nur wenn ich das tue, kann ich mich öffnen nach aussen, im Wissen, dass ich sein darf, wie ich bin, dass ich auch anders sein darf, und doch in Ordnung bin. Aus diesem Wissen heraus kann ich mit einem Selbstverständnis auf andere zugehen, das diesen ihr Sein auch lässt, das uns in unserem jeweiligen So-Sein verbindet auch als Verschiedene, so dass daraus eine Beziehung entsteht, die auf Verständnis, Vertrauen, Zugewandtheit basiert. Wo würde man sich wohler fühlen als im Kreis von Menschen, die ein solches Miteinander leben? Wo wäre man mehr zuhause als da, wo man sich als Ich anerkannt fühlt und sich nicht schützen muss vor Verletzungen und Angriffen, wo man nicht in Angriffsstellung stehen muss, um gefürchtete Verletzungen abwehren zu können?
Es ist nicht immer leicht, die alten Muster abzulegen, die durch jahrelange Erfahrungen und Prägungen zustande kamen. Oft greifen sie in die Kindheit zurück, wurden da gefestigt und in die Seele gemeisselt. Veränderung braucht immer Zeit. Am besten gelingt sie an einem Ort, an dem man sich geschützt weiss, an dem man weiss: Hier darf ich sein. Und auch werden. Schön, wenn man (manchmal auch einen) Menschen gefunden hat, die (der) einem das vermittelt. Vielleicht ist das dann Zuhause. Weil da Liebe herrscht und nicht Hass und Ablehnung. Ganz im Sinne von bell hooks Satz:
«Liebe ist die einzige Kraft, die einen Feind in einen Freund verwandeln kann.» bell hooks
Nicht dass vorher alle Menschen Feinde gewesen wären, aber die Angst, dass sie es sein könnten, hat eine wahre Begegnung verunmöglicht und damit ein Zuhause unmöglich gemacht.
___
Buchempfehlung zum Thema:
bell hooks: Dazugehören. Über eine Kultur der Verortung
bell hooks wächst in Kentucky auf, verlässt den ländlichen Staat, um in der Stadt ihr Leben weg von der Arbeiterklasse und im universitären Umfeld zu führen. Sie schreibt vom Wunsch, dazuzugehören, von Rassismus, der auf dem Papier abgeschafft, doch im Leben präsent wie eh und je ist. Sie schreibt vom Trost der Natur, vom Wert der Familie, der Kunst und des sorgsamen Umgangs mit Menschen und der Welt. Sie träumt von einer Welt des Miteinanders, einer Welt der Zugehörigkeit ohne Rassismus und Segregation. Und sie schreibt von ihrer Rückkehr nach Kentucky, den Ort, den sie überall hin mitgenommen hat durch die verinnerlichten Werte und Muster, und wo sie sich nun niederlassen will.
(bell hooks: Dazugehören. Über eine Kultur der Verortung, Unrast Verlag, Münster 2022.