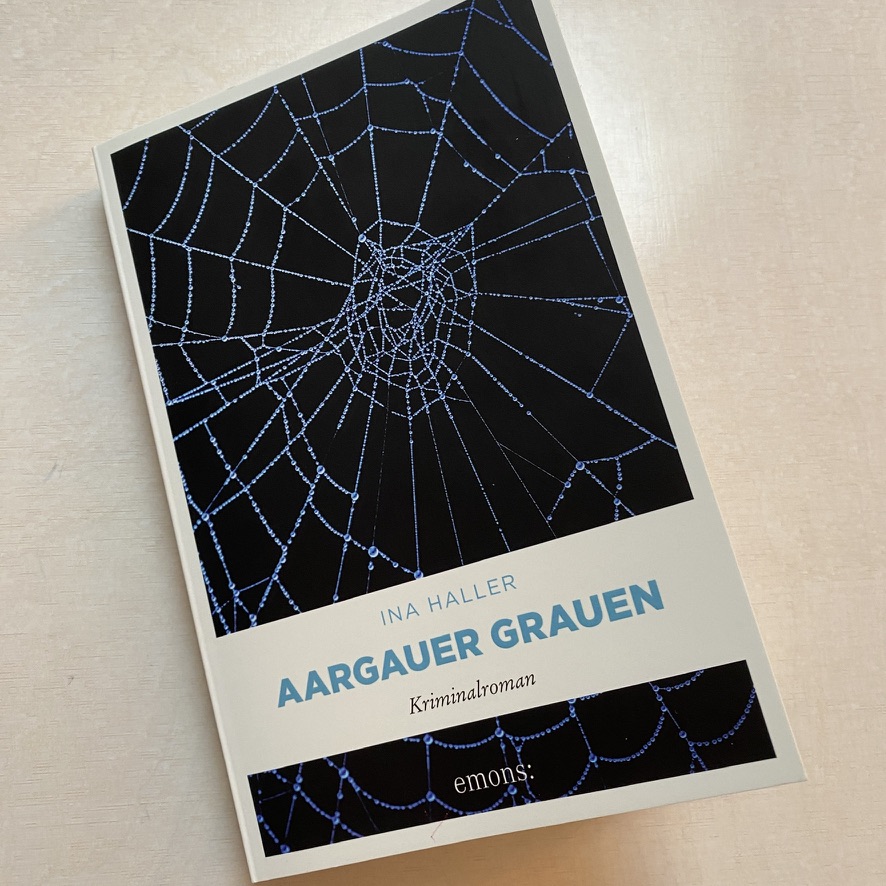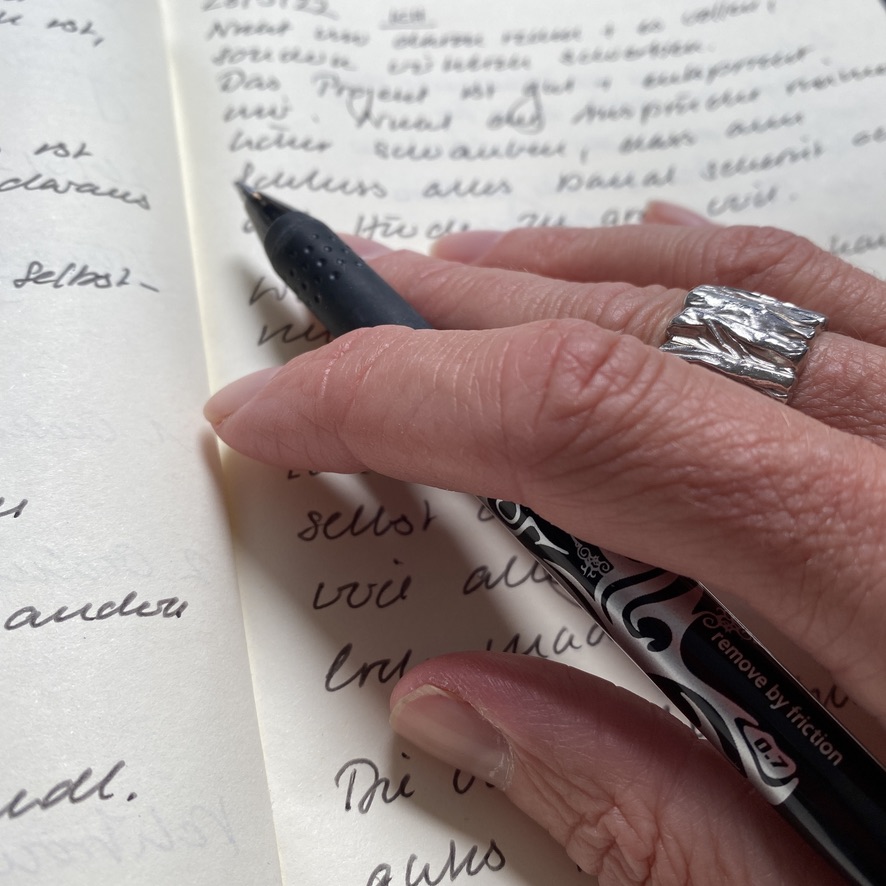T.M. Logan wurde in Berkshire als Sohn eines englischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Er war Wissenschaftsreporter bei der Daily Mail und arbeitete anschließend in der Hochschulkommunikation. Seit 2017 lebt T.M. Logan vom Schreiben – und das sehr erfolgreich: Mit seinen Thrillern hat er ein ums andere Mal Bestseller geschrieben und in England bereits ein Millionenpublikum begeistert. Auf Deutsch von ihm erschienen sind u.a. «Trust me», «The Parents», «The Catch», «Holiday». Seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen übersetzt, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Koreanisch. Der Autor lebt mit seiner Familie in Nottinghamshire.
Wer bist du? Wie würdest du deine Biografie erzählen?
Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern (eine Tochter, 24, und einen Sohn, 21). Acht Jahre lang war ich Journalist und habe danach im Kommunikationsteam einer Universität gearbeitet, bis 2017 mein erster Roman veröffentlicht wurde – seitdem habe ich jedes Jahr ein Buch geschrieben und nun acht Bücher in Großbritannien veröffentlicht. Ich lebe in Nottingham, in der Nähe von dem Ort, an dem meine Frau Sally aufgewachsen ist.
Du bist als Sohn eines englischen Vaters und einer deutschen Mutter aufgewachsen. Hat dich dies in einer Weise beeinflusst? Durch unterschiedliche Kulturen oder Sprachen?
Meine Mutter Vera wurde in Leipzig geboren und ist in Köln aufgewachsen, bevor sie 1963 nach England zog, um meinen Vater zu heiraten. In meiner Kindheit habe ich oft mit meiner Familie Deutschland besucht, um Verwandte und Freunde zu sehen. Dadurch fühle ich mich sehr europäisch. Dass ich als Kind zu Hause Deutsch hörte, half mir zu erkennen, dass es viele verschiedene Arten gibt, eine Geschichte zu erzählen, und das neben den Erzähltraditionen, mit denen ich in Großbritannien aufgewachsen bin, viele andere Erzähltraditionen existieren.
Wieso schreibst du? Wolltest du schon immer Schriftsteller werden oder gab es einen Auslöser für dein Schreiben?
Ich schreibe, weil ich es liebe! Schreiben war schon immer etwas, das ich tun wollte, seit meiner Teenagerzeit. Schreiben hat mich in die Welt des Journalismus gezogen. In meinen Dreißigern wurde mir klar, dass das Schreiben eines Buches ein weiteres Maß an Engagement erfordern würde. Ich war entschlossen herauszufinden, ob ich es schaffen könnte. Ich setzte mir das Ziel, jeden Tag 45 Minuten bis eine Stunde zu schreiben, vielleicht kamen dabei jeweils nur 300-400 Wörter heraus. Ich wollte sehen, ob ich das durchziehen könnte, bis ich ein vollständiges Buch habe.
Es heisst, Ideen liegen auf der Strasse, doch nicht jeder sieht dasselbe, interessiert sich für dasselbe. Wo findest du generell deine Ideen?
Oft finde ich die erste Inspiration im Alltag. Zum Beispiel kam die Idee für The Parents einfach von einer der Nächte, in denen ich darauf wartete, dass mein Sohn von einem Abend mit seinen Freunden nach Hause kam. Es war nach Mitternacht, und ich lag im Bett und fragte mich, wo er war und wann er zurückkommen würde – dann begann ich zu überlegen, was ich tun würde, wenn er in Schwierigkeiten oder in ein Verbrechen verwickelt worden wäre. Holiday wurde durch die jährliche Reise meiner Frau mit drei ihrer besten Freundinnen inspiriert. Die Inspiration für The Catch kam ursprünglich durch den Freund meiner Tochter, sie war damals noch ein Teenager.
Wenn du auf deinen eigenen Schreibprozess schaust, wie gehst du vor? Entsteht zuerst ein durchdachtes Gerüst, ein Konvolut an Notizen oder aber schreibst du drauflos und schaust, wo dich das Schreiben hinführt?
Ich plane gerne einen Teil der Geschichte und habe eine gute Übersicht, bevor ich anfange. Ich verbringe 4-6 Wochen damit, den Plan, den Hauptbogen der Geschichte, einige der wichtigen Ereignisse und Wendepunkte auf dem Weg auszuarbeiten. Beim Schreiben beginnen dann die Charaktere oft, sich zu behaupten, und verändern dadurch Aspekte der Geschichte auf eine Weise, die ich ursprünglich nicht geplant hatte.
Wie sieht es mit dem Schreibmaterial aus? Schreibst du den ersten Entwurf von Hand oder hast du gleich in die Tasten? Wenn von Hand, muss es dieser eine Füller sein oder das immer gleiche Papier?
Ich plane zuerst auf Papier, mit Bleistift in einem Notizbuch. Aber dann wechsle ich zum Computer, um die Geschichte selbst zu schreiben – ich benutze ein Programm namens Scrivener, das hilft, die gesamte Form der Geschichte zu sehen. Ich konvertiere es in Word, bevor ich es an meinen Lektor schicke, und gehe dann alle Bearbeitungen in Word durch.
Ich hörte mal, der grösste Feind des Schriftstellers sei nicht mangelndes Talent, sondern die Störung durch andere Menschen. Ich glaube, du würdest dem zustimmen?
Es kann schwierig sein, Zeit zum Schreiben zu finden. Das war besonders der Fall, als ich in einem Vollzeitjob arbeitete und meine Kinder noch kleiner waren: Es gab fast immer Unterbrechungen im Laufe des Tages. Ich habe einfach versucht, jeden Tag mindestens 45 Minuten zum Schreiben zu finden – manchmal spät am Abend oder früh morgens, bevor meine Kinder aufwachten, wenn es weniger Ablenkungen gab.
Thomas Mann hatte einen strengen Tagesablauf, in dem alles seine zugewiesene Zeit hatte. Wann und wo schreibst du? Bist du auch so organisiert oder denkst du eher wie Nietzsche, dass aus dem Chaos tanzende Sterne (oder Bücher) geboren werden?
Ich versuche, an Wochentagen von 8 Uhr morgens bis zum Mittag zu schreiben, und nutze den Nachmittag für administrative Aufgaben, E-Mails, soziale Medien, meine Website usw. Auch zum Lesen! Aber generell arbeitet mein kreatives Gehirn besser am Morgen, also versuche ich, diese Zeit dem Schreiben zu widmen. Ich weiß, dass diese vier Schreibstunden am Morgen der wichtigste Teil meines Arbeitstages sind – alles andere ist zweitrangig.
Was sind für dich die Freuden beim Leben als Schriftsteller, was bereitet dir Mühe?
Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist das größte Vergnügen und Privileg des Schreibens. Menschen und Geschichten zum Leben zu erwecken, ist mein Lieblingsteil des Prozesses. Allerdings kann das Bearbeiten manchmal eine Herausforderung sein, aber es ist ein notwendiger und wichtiger Teil des Prozesses – auch wenn es sich anfühlt, als würde man die Geschichte auseinandernehmen und Stück für Stück wieder zusammenfügen.
Hat ein Schriftsteller je Ferien oder Feierabend? Wie schaltest du ab?
Ich habe normalerweise an den Wochenenden frei und mache Urlaub mit meiner Frau und manchmal mit Freunden. Zum Abschalten lese ich, ob Belletristik oder Sachbücher, höre Podcasts und Hörbücher, schaue eine Serie im Fernsehen (ich genieße gerade Ted Lasso und Slow Horses) oder spiele Tennis.
Du hast als Wissenschaftsreporter gearbeitet, bevor du zum Schreiben von Büchern übergingst. Wieso hast du dich für Thriller entschieden?
Ich schreibe das, was ich selbst gerne lese, und deshalb habe ich mich für Thriller entschieden. Es ist mein Lieblingsgenre und das schon seit meinen Zwanzigern.
Es gibt die Einteilung zwischen hoher Literatur und Unterhaltungsliteratur (was oft einen abschätzigen Unterton in sich trägt). Was hältst du von dieser Unterteilung und hat sie einen Einfluss auf dich und dein Schreiben?
Wir haben eine ähnliche Trennung im Vereinigten Königreich! Aber es stört mich nicht allzu sehr. Es gibt hier eine gewisse Arroganz gegenüber Unterhaltungsliteratur oder Massenmarkt-Büchern, aber ich ignoriere das meistens. Vielfalt ist eine gute Sache und ich mag es, dass es Bücher für jeden Geschmack und jede Vorliebe gibt – meine Romane sind nur ein Teil davon.
In deinem Buch „The Parents“ schreibst du über das wohl Schlimmste, was Eltern passieren kann: Ihr Kind verschwindet. Dabei belässt du es aber nicht, sondern das Kind taucht wieder auf, steht nun aber unter Verdacht, eine grausame Tat begangen zu haben. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was fasziniert dich daran?
Mich interessieren immer die Grauzonen, die zwischen richtig und falsch, zwischen weiss und schwarz liegen. Weiss und Schwarz sind nicht so interessant, es gibt keine Nuancen, keinen Zweifel. Aber wenn man sich irgendwo dazwischen befindet, ist das aus meiner Sicht als Leser und Schriftsteller viel faszinierender. Wir alle lieben unsere Kinder, aber wie weit würden wir gehen, um sie zu schützen, wenn sie etwas Schreckliches getan haben oder wir den Verdacht haben, dass sie es getan haben?
Goethe sagte, alles Schreiben sei autobiografisch. Nun ist jeder Mensch ein Kind seiner Zeit und seines Umfelds, wie viel von dir steckt in deinen Romanen, in den einzelnen Figuren?
Es gibt in vielen meiner Charaktere Teile von mir. Sicherlich in den Protagonisten der Geschichten. Ich greife auch auf meine eigenen Kinder und deren Erfahrungen zurück, manchmal auf die Eigenschaften meiner Frau und anderer Menschen, die ich kenne.
Was treibt dich immer wieder an, noch ein Buch zu schreiben? Oder anders gefragt: Wäre ein Leben ohne zu schreiben denkbar für dich?
Ich liebe es, neue Geschichten zu erschaffen, und ich sehe nicht, dass ich so bald damit aufhören werde. Ich werde immer das Bedürfnis haben, etwas zu schreiben, was auch immer es ist. Ich denke, es wird immer einen Teil von mir geben, der eine neue Geschichte erschaffen will, der die Charaktere treffen und herausfinden möchte, wie alles endet.
Was muss ein Buch haben, damit es dich beim Lesen begeistert und wieso? Legst du Wert auf das Thema, die Sprache oder die Geschichte? Ist das beim eigenen Schreiben gleich?
Wenn ich lese, können es verschiedene Dinge sein – ein Charakter, der auf den Seiten zum Leben erwacht, ein großartiger Aufhänger, eine unerwartete Wendung, fesselnde Dialoge oder einfach eine schnelllebige Geschichte, mit der ich mich auf irgendeine Weise identifizieren kann. Ich mag es, all diese Elemente in meinen eigenen Romanen zu haben.
Wenn du fünf Bücher nennen müsstest, die in deinem Leben eine Bedeutung haben oder die du anderen empfehlen möchtest, welche wären es?
- A Simple Plan von Scott Smith
- Tell No-One von Harlan Coben
- The Silence of the Lambs von Thomas Harris
- On Writing von Stephen King
- Into the Woods von John Yorke
Was rätst du einem Menschen, der ernsthaft ein Buch schreiben möchte?
Lies viel und nimm so viel wie möglich auch aus anderen Medien auf. Sei ein Schwamm, der alles aufsaugt. Schreibe das Buch, das du selbst gerne lesen würdest. Versuche, dir jeden Tag ein bisschen Zeit dafür freizuhalten, denn Schreiben ist wie Laufen, eine Sprache zu lernen oder jede andere neue Fähigkeit zu erwerben: Du wirst durch regelmäßiges Üben besser. Leider gibt es wirklich keine Abkürzungen!
Herzlichen Dank Tim, dass du dir die Zeit für diese wunderbaren Antworten genommen hast!