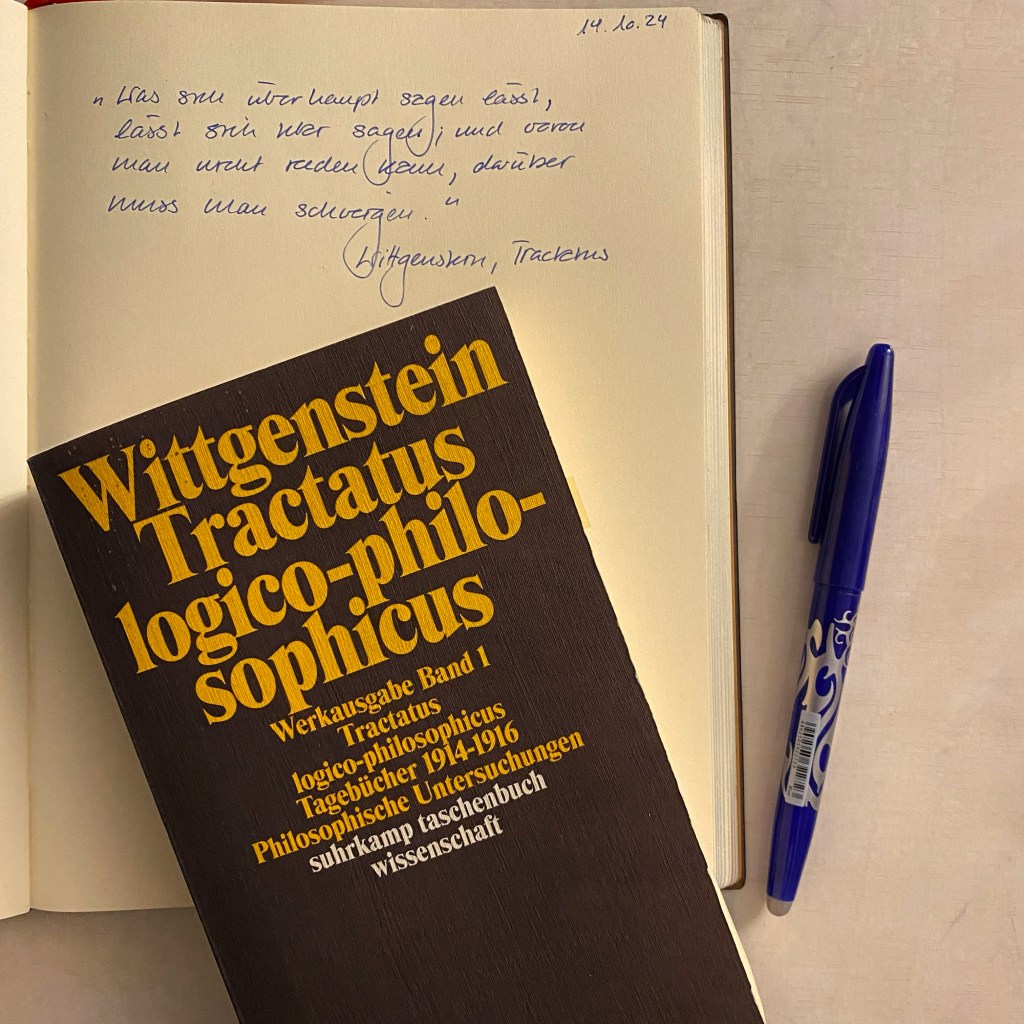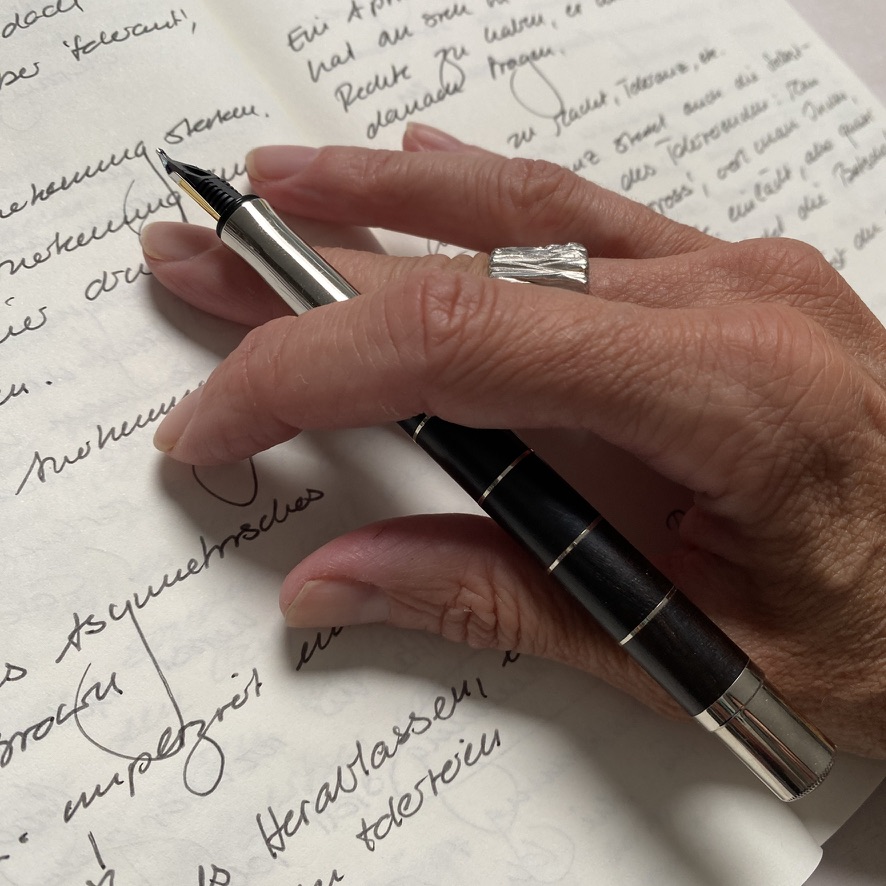Ina Haller wurde in Wuppertal geboren. Nach der Schule studierte sie Geologie und arbeitete danach in einem Schweizer Versicherungsunternehmen. Sie lebt mit ihrer Familie im Kanton Aargau (in der Schweiz). Seit der Geburt ihrer drei Kinder ist sie »Vollzeit-Familienmanagerin« und Autorin. Zu ihrem Repertoire gehören Kriminalromane sowie Kurz- und Kindergeschichten.
Wer bist du? Wie würdest du deine Biografie erzählen?
Viel Spektakuläres gibt es da nichts zu erzählen. Ich wurde in Nordrhein-Westfalen geboren und bin dort zusammen mit meinem älteren Bruder aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Abitur lernte ich meinen heutigen Mann bei einem Sprachaufenthalt kennen und zog nach dem Geologiestudium zu ihm in die Schweiz.
Heute lebe ich mit meiner Familie im Aargau.
Ich reise gerne und ich bin ein Bewegungsmensch – Joggen, Wandern, Velofahren gehören für mich zum Alltag. Ich muss jeden Tag raus, auch wenn es nur ein Spaziergang ist. Besonders liebe ich es in der Natur zu sein. Dort finde ich Ruhe und meine kriminellen Ideen, vor allem, wenn ich beim Schreiben einmal steckengeblieben bin
Wieso schreibst du? Wolltest du schon immer Schriftsteller werden oder gab es einen Auslöser für dein Schreiben?
Eigentlich habe ich nie gerne geschrieben. Meine Deutschlehrerin fand das, was ich zu Papier brachte, nicht besonders gut. Entsprechend sahen meine Noten aus 😊. Das war nicht gerade die Motivation, mit dem Schreiben zu beginnen …
Nach der Geburt unserer zweiten Tochter las zufällig ich in der Zeitung vom „Novemberschreiben“. Da habe ich einfach mal mitgemacht und merkte schnell, dass das Schreiben ein wunderbarer Ausgleich zum turbulenten Familienalltag mit kleinen Kindern ist, der emotional und körperlich anstrengend ist. Doch der Kopf kommt dabei zu kurz. Beim Schreiben war plötzlich der Kopf gefordert und das hat gutgetan. Als die Kinder grösser wurden, bin ich dabei geblieben.
Es heisst, Ideen liegen auf der Strasse, doch nicht jeder sieht dasselbe, interessiert sich für dasselbe. Wo findest du generell deine Ideen?
Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Häufig ist die Idee plötzlich da.
Hilfreich beim Finden von Ideen ist es, mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend zu laufen. Viel braucht es nicht, damit die Gedankenmaschinerie in meinem Kopf anspringt.
Eine weitere wunderbare Fundgrube ist meine Familie. Die Themen am Familientisch sind nicht unbedingt etwas für schwache Nerven. Z.B. der Auslöser der Idee zu Aargauer Grauen war meine Tochter. Wir waren Skifahren und machten gerade Mittagspause. Sie sagte, sie habe etwas Grässliches im Internet gesehen und zeigte mir das Bild einer Spinne. Und schon steckten wir in der Entwicklung eines Plots …
Wenn du auf deinen eigenen Schreibprozess schaust, wie gehst du vor? Entsteht zuerst ein durchdachtes Gerüst, ein Konvolut an Notizen oder aber schreibst du drauflos und schaust, wo dich das Schreiben hinführt?
Ich bin überhaupt nicht organisiert, sondern total chaotisch.
Der Schluss meiner Geschichte bildet stets den Ausgangspunkt: Das Motiv, die Tatwaffe, der Täter oder die Täterin. Von dort aus entwickle ich die Handlungen. Aber, wie gesagt, nicht geordnet, sondern ich schreibe drauf los. Generell ist das Schreiben für mich wie das Lesen eines Buches, das aber noch nicht existiert und daher aufgeschrieben werden muss. Oft passiert es mir, dass meine Protagonisten mir sagen, wo es lang geht, und ich erlebe dabei viele Überraschungen.
Wie sieht es mit dem Schreibmaterial aus? Schreibst du den ersten Entwurf von Hand oder hast du gleich in die Tasten? Wenn von Hand, muss es dieser eine Füller sein oder das immer gleiche Papier?
Ich schreibe direkt am Computer. Entweder im Büro oder bei schönem Wetter mit meinem Laptop auf der Terrasse. Wenn mir etwas einfällt und ich nicht gerade am Computer sitze, wird der Gedanke auf einem Notizzettel notiert.
Ich hörte mal, der grösste Feind des Schriftstellers sei nicht mangelndes Talent, sondern die Störung durch andere Menschen. Ich glaube, du würdest dem zustimmen?
Keine Ahnung. Bisher werde ich nur durch meine Familie gestört. Meine Töchter haben ein besonderes Talent, genau dann zu mir zu kommen, sobald ich mich hingesetzt habe. Aber Auswirkungen auf mein Schreiben hat das nicht.
Thomas Mann hatte einen strengen Tagesablauf, in dem alles seine zugewiesene Zeit hatte. Wann und wo schreibst du? Bist du auch so organisiert oder denkst du eher wie Nietzsche, dass aus dem Chaos tanzende Sterne (oder Bücher) geboren werden?
Mit einer Familie muss ich mir Schreibzeiten einrichten. Besonders, als die Kinder klein waren. Da hatte ich „meine Zeit“, während sie Mittagsschlaf gemacht haben. Diese Zeit ist heute geblieben.
Meine Schreiborte sind mein Büro oder mit dem Laptop auf der Terrasse. In einem Café, wie andere das machen, könnte ich nicht schreiben. Ich hätte das Gefühl, es würde mir immer jemand über die Schulter schauen und das ist etwas, das ich gar nicht mag.
Was sind für dich die Freuden beim Leben als Schriftsteller, was bereitet dir Mühe?
Schreiben ist für mich ein Hobby (leben kann ich davon nicht). Und was bereitet mehr Freude, als das zu tun, was einem Spaß macht? Aber ich mache nicht alles gleich gern, wie zum Beispiel das sprachliche Überarbeiten, das zwar notwendig aber mühselig ist.
Hat ein Schriftsteller je Ferien oder Feierabend? Wie schaltest du ab?
Abschalten kann ich am besten beim Sport oder wenn ich in der Natur bin. Das heißt aber nicht, dass meine Gedanken dann nicht hin und wieder zu meinen Protagonisten driften. Das finde ich aber nicht belastend – sie gehören ja zu mir.
Doch Ferien vom Schreiben habe ich auch. Hin und wieder muss der Kopf geleert werden, damit Neues Platz hat – zum Beispiel bei einer mehrtägigen Wanderung in diesem Sommer.
Goethe sagte, alles Schreiben sei autobiografisch. Nun ist jeder Mensch ein Kind seiner Zeit und seines Umfelds, wie viel von dir steckt in deinen Romanen, in den einzelnen Figuren?
Ich denke, das passiert automatisch und unabsichtlich, dass in den Figuren und im Roman etwas von mir steckt. Sicher fließen Erfahrungen von mir ein und Dinge, die ich selbst erlebt habe. Sei es kleine Szenen aus dem Alltag oder „größere“ Erfahrungen. Bei Rüebliland sind zum Beispiel die Szenen in Indien Eindrücke und Erfahrungen, die ich auf unserer Reise erlebt habe.
Deine Krimis spielen in der Region, in der du selbst lebst. Wieso hast du dich dafür entschieden und nicht die Chance gepackt, schreibend neue Gegenden zu erkunden?
Bei der Aargauer Reihe ist es so, da ich hier wohne. Aber bei der Reihe mit Samantha ist es anders. Ich kannte das Baselbiet nicht und lerne zusammen mit Samantha schreibend diesen Kanton kennen.
Für mich ist es wichtig, dass die Leserin/der Leser die Gegend in meinen Büchern „spüren“ kann. Es reichen schon Kleinigkeiten wie das Rauschen des Verkehrs auf einer Straße oder der Duft einer Bergwiese, um die Geschichte lebendig werden zu lassen. Das kann Google Maps nicht vermitteln und daher muss ich an den Ort gehen. Da ist es natürlich praktisch, wenn der Handlungsort vor der Haustür liegt.
Wenn ich die Gelegenheit habe, weiter weg zu reisen, lasse ich diese Eindrücke in meine Bücher einfließen (z.B. wie in Rüebliland oder Samanthas neuen Fall, der im Frühling 2025 erscheint).
Wie findest du die Namen deiner Figuren? Mir fiel auf, dass die Protagonisten alle italienischen Ursprung hatten (ausser Jamila), die anderen Figuren hiesigen. Gibt es dafür einen Grund?
Das ist Zufall. Wobei Andrina eine Bündner Großmutter hat und Enrico aus Süditalien stammt.
Für die Namen meiner Figuren schnappe ich entweder einen Namen auf oder ich surfe durch Telefonbücher oder auf Webseiten für Babynamen.
Es gibt die Einteilung zwischen hoher Literatur und Unterhaltungsliteratur (was oft einen abschätzigen Unterton in sich trägt). Was hältst du von dieser Unterteilung und hat sie einen Einfluss auf dich und dein Schreiben?
Mir gefällt diese Unterteilung gar nicht, besonders, wenn es abwertend gemeint ist. Mehr als einmal wurde mir gesagt, Krimis sind keine Literatur. Aber das stimmt überhaupt nicht. Literatur ist für mich alles, was mit dem Verfassen von Texten zu tun hat, also egal, ob es ein Gedicht, ein Krimi oder ein Liebesroman ist. In jedem Text steckt Herzblut und jeder Text unterhält auf seine eigene Art.
Auf mein Schreiben hat diese Unterteilung keinen Einfluss. Ich schreibe das, was mir gefällt und was mir Spaß macht.
Was treibt dich immer wieder an, noch ein Buch zu schreiben? Oder anders gefragt: Wäre ein Leben ohne zu schreiben denkbar für dich?
Ein Leben ohne Schreiben … Ganz ehrlich kann ich es mir im Moment nicht vorstellen. Schreiben ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Es ist für mich ein Ausgleich und ich kann in eine andere Welt eintauchen.
Allerdings weiß ich nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist. Doch solange ich Ideen und weiterhin Freude daran habe, werde ich auf jeden Fall weiterschreiben.
Du bewegst dich in unterschiedlichen Genres, schreibst Krimis, Kurzgeschichten, Kindergeschichten. Wieso diese Vielfalt? Wäre es nicht einfacher, bei einem, das „funktioniert“, zu bleiben?
Einfacher wäre es vielleicht schon, aber auch langweiliger. Auch beim Schreiben braucht es hin und wieder eine Abwechslung und Herausforderung, wobei mein Hauptfokus die Krimis sind.
Gibt es einen Unterschied in deinem Schreibprozess in den unterschiedlichen Genres?
Eigentlich nicht. Ich habe eine Idee, fange einfach an und schreibe die Geschichte. Danach muss jeder Text den Überarbeitungsprozess durchlaufen. Dabei ist es egal, ob es ein Krimi oder eine Kurzgeschichte ist.
Was muss ein Buch haben, damit es dich beim Lesen begeistert und wieso? Legst du Wert auf das Thema, die Sprache oder die Geschichte? Ist das beim eigenen Schreiben gleich?
Allgemein schaue ich zuerst auf den Klappentext. Wenn dieser mich vom Thema und der Geschichte her anspricht, hat das Buch eine Chance, gelesen zu werden.
Ich muss die Protagonisten spüren und in sie hineinschlüpfen können. Der Anfang sollte nicht langatmig gehalten sein und die Sprache muss für mich passen. Wenn es mich nach zwanzig / dreißig Seiten nicht in den Bann gezogen hat, hat das Buch keine Chance mehr bei mir.
Zum Beispiel schätze ich es gar nicht, wenn das Erzählen in den verschiedenen Perspektiven nicht sauber umgesetzt ist, es viele inhaltliche Wiederholungen, zu viele Längen mit Nebensächlichkeiten, Adjektive oder Füllwörter hat.
Das sind alles Dinge, auf die ich beim eigenen Schreiben ebenfalls achte, wobei es mir bei anderen eher auffällt, wenn etwas nicht stimmig ist, als bei mir selbst. Daher bin ich meiner Lektorin und ihrem scharfen Auge dankbar, wenn sie gnadenlos ihren Rotstift schwenkt.
Wenn du fünf Bücher nennen müsstest, die in deinem Leben eine Bedeutung haben oder die du anderen empfehlen möchtest, welche wären es?
Puh, das ist schwierig. Allgemein hat jedes Buch für mich eine Bedeutung.
Von meinen eigenen Büchern gibt drei, die eine starke persönliche Bedeutung für mich haben: Rüebliland, Aargauer Grauen und Samanthas 7. Fall, der 2025 erscheint, dessen Titel ich aber hier noch nicht sagen darf.
Ansonsten fallen mir spontan die Krimis von Romy Fölck und Kathy Reichs ein. Mir gefallen ihre Erzählstile und die Leichtigkeit, mit denen sie geschrieben sind.
Was rätst du einem Menschen, der ernsthaft ein Buch schreiben möchte?
- Zuerst: Lesen, lesen, lesen.
- Recherchieren (sowohl den Ort als auch Fachliches)
- Und dann: anfangen.
- Sich nicht verunsichern lassen, nie aufgeben, sich nicht selbst im Weg stehen, Zweifeln keine Chance geben, hartnäckig sein und an sich glauben.
- (Konstruktive) Kritik zulassen und offen für Ratschläge sein, sich aber auch dickes Fell zulegen und nicht herunterziehen lassen.
- Nicht verbissen werden, sondern Freude am Schreiben haben und behalten.
- Ein offenes Ohr für seine Protagonisten haben und zulassen, was sie dir zuflüstern, auch wenn die Wendung der Geschichte womöglich für den Moment nicht passend scheint.
- Es nicht von Anfang an perfekt machen zu wollen, sondern einfach schreiben. Das Überarbeiten (was sehr wichtig ist) kommt später, muss aber dann gewissenhaft erledigt werden.
- Kontakt zu anderen Schreibenden haben. Nur im Austausch bekommst du Tipps und Hilfe.
Herzlichen Dank, liebe Ina, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen und uns so ein paar Einblicke in deinen Schreiballtag gewährt hast.