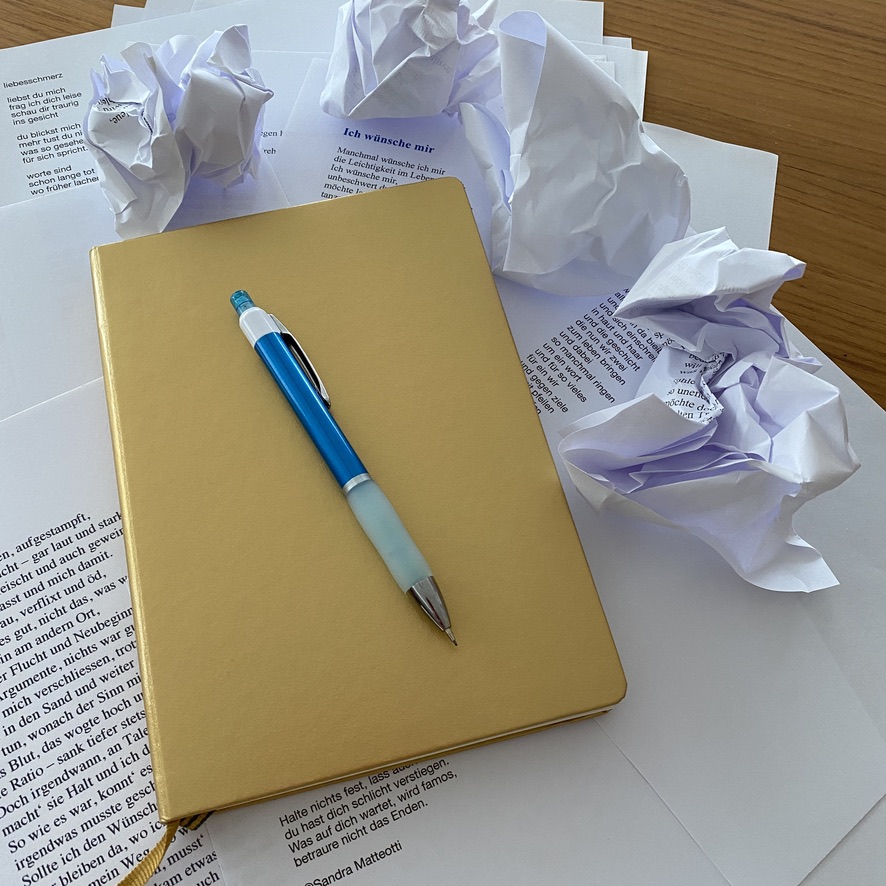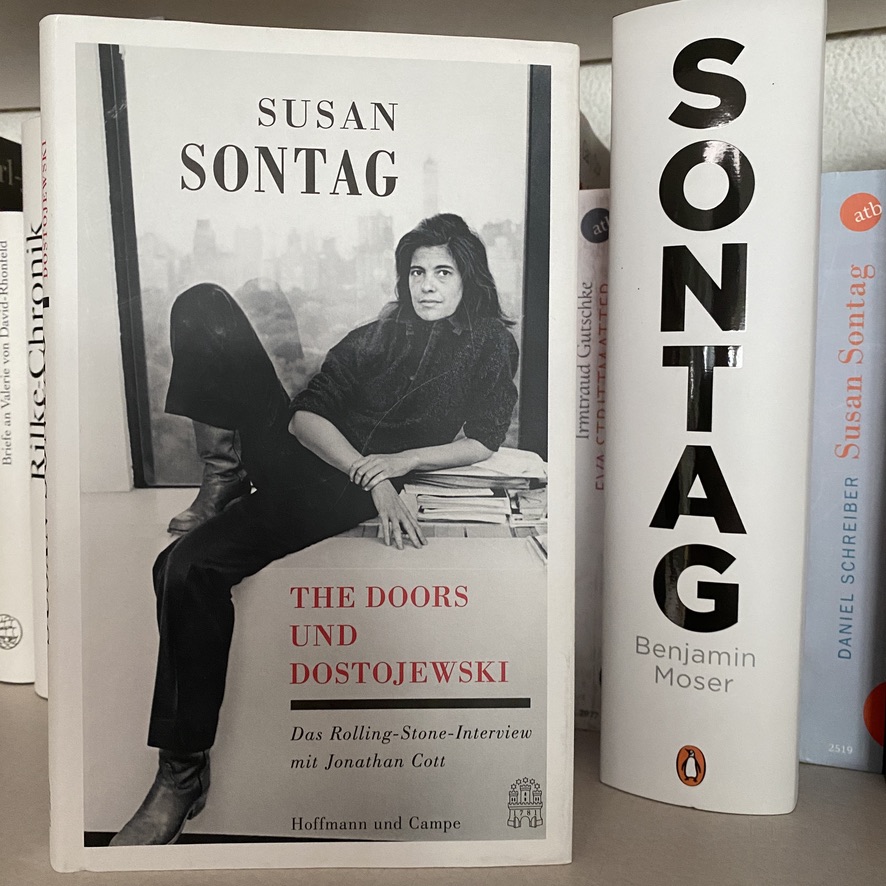Lieber Papa
Ach Papa, wer warst du wirklich? Manchmal denke ich, ich habe dich gar nicht richtig gekannt. Habe ich nicht gut genug hingeschaut? Oder wolltest du dich nicht zeigen? Wieso? Was hast du versteckt? Was war nur Schauspiel? Was echt?
Ich wusste als Kind nichts von deiner Vergangenheit. In späteren Jahren hast du ab und zu etwas erzählt, meist Oberflächliches. Lustiges. Nie Tiefes. Oder Persönliches.
Gotti hat mir ein paar Bruchstücke erzählt. Als deine ältere Schwester kannte sie dich länger. Aber auch sie wusste nur, was man von aussen sah. Ich weiss nicht mehr, wie wir dazukamen. So erfuhr ich von einem düsteren Kapitel aus deinem Leben. Dinge, die du nicht lachend weggesteckt hast. Du hast nie davon gesprochen. Wieso? Hast du dich geschämt? Ging es mich in deinen Augen nichts an? Hast du es verdrängt?
Was sie erzählte und was ich erlebte, passte nicht zusammen. Es liess sich nicht in Einklang bringen. Als ob hinter deiner heutigen Maske ein vergangenes (echtes?) Gesicht verborgen wäre. Verbogen für alle anderen. Auch für mich. So hast du alle auf Distanz gehalten. Auch mich. Das fühlt sich nicht schön an. Ein Teil deiner Maske war das Schweigen. Etwas, das du in deiner Familie gelernt hast.
„Darüber spricht man nicht.“
Was nicht gesagt wurde, existierte nicht. Präsentiert wurde nur die glatte Oberfläche. Die, welche man auf Hochglanz poliert hatte. Was störte, wurde unter den Teppich gekehrt. Stillschweigend. Einvernehmlich. So sollte es sein. Die Teppiche waren geräumig. Ganze Menschen hatten unter ihnen Platz. Zum Beispiel Grossvati. Vom verehrten Familienoberhaupt zur Persona non grata. Von heute auf morgen.
„Wir sprechen nicht mehr über Grossvati.“
Hiess es.
„Was ist passiert?“
„Das tut nichts zur Sache.“
Die Botschaft war klar. Das Thema war durch. Was folgte, war Schweigen. Zu dem Zeitpunkt war er schon viele Jahre tot. Es war ein Sockelsturz post mortem. Er starb quasi zum zweiten Mal. Ich verstand nicht, wie man einen Menschen erst lieben und loben und dann fallen lassen konnte. Ich habe auf all meine Fragen nie eine Antwort bekommen. Es gab ein paar Andeutungen. Ich weiss nicht mehr von wem. Frauengeschichten, Schulden. Alles unzusammenhängend und vage. Ich hatte ihn gerngehabt. Es war, als ob ich das nicht mehr dürfte. Was mir bleibt, ist die Erinnerung. Ich erinnere mich an die Besuche bei ihm. Er sass in seinem Sessel. Schon schlecht auf den Füssen. Ich war noch klein. Ich krabbelte vor ihn, zog ihm seine Finken aus. Ganz schnell. Er schaute runter, als ob er mich vorher nicht gesehen hätte. Und dann lachte er. Er lachte so sehr, dass sein ganzer Körper wackelte. Und da war viel, das wackeln konnte. Ich habe es geliebt. Mehr Erinnerungen an ihn habe ich nicht.
Wer war Grossvati, bevor er Grossvati wurde? Ich weiss es nicht. Es hiess mal, er hätte gerne Geschichte studiert. Das Geld fehlte, also machte er eine Lehre. Als Metzger. Weil man da immer zu essen hätte. Das glaubte er. Der Beruf machte ihm keine Freude. Später wurde er Schlachtermeister am Schlachthof Zürich. Und er litt mit den Tieren mit. Ging jedes Wochenende hin und fütterte und tränkte sie, war bei ihnen. Dann war er Wirt. Hätte die Braunen aus dem Lokal geworfen. Trotz Drohungen. Das habt ihr stolz erzählt, als er noch ein Held für euch war. Auch das zählte nicht mehr.
Wie war er für dich als Vater? Wie war deine Beziehung zu ihm? Ich weiss nur, dass er dich mal mit dem Gürtel verprügelte und du dir dann geschworen hast, dein Kind nie zu schlagen. Das hast du gehalten. Und noch eine Geschichte hast du lachend erzählt. Vom Krieg. Als das Essen knapp war. Eines Tages hättet ihr Kaninchenbraten auf dem Tisch gehabt. Euch gefreut. Bis deine Schwester nach der Katze fragte. Und Schweigen zurückkam. Grossvati hatte die Katze geschlachtet, um euch etwas auf den Tisch zu bringen. Keiner hätte einen Bissen gegessen. Er sei wütend geworden. Ich vermute, auch traurig. War es nicht gut gemeint gewesen? Während ich das schreibe, frage ich mich, wann die Geschichte für dich lustig wurde. Das waren die Geschichten, die du erzählt hast. Es waren wenige. Wie ging es dir mit all dem? Das hast du nie erzählt. Auch später nicht. Wenn ich dich fragte, wie es dir geht, kam zurück:
„Es geht mir gut.“
Du zogst diese Worte morgens an wie eine Uniform und trugst sie durch den Tag. Du warst ein Meister der Tarnung. Du lehrtest auch mich, nie zu zeigen, dass es mir schlecht geht. „Von Menschen, denen es nicht gut geht, wendet man sich ab“, sagtest du. Ich war leider nie so gut in meiner Tarnung wie du. Gute Miene zum bösen Spiel? Lag mir nie. Selbst wenn ich mich bemühte und versuchte, so zu tun, als sei alles gut: Man sah mir das Gegenteil an. Wie oft hast du mich dafür gerügt.
„Trag dein Herz nicht immer auf der Zunge!“
Hast du gesagt.
„So will niemand mit dir zusammen sein!“
Hast du gesagt. Ich habe es geglaubt. Ich glaube dir bis heute. Will es einer doch, hat er nur noch nicht gemerkt, wie ich bin. Spätestens dann ist er weg. Deine Sätze, deine Überzeugungen, deine Lehren, sie begleiten mich durchs Leben.
Wie bist du eigentlich zu dem Schluss gekommen? Dass man Menschen nicht mag, die nicht immer fröhlich sind? Mochtest du sie nicht? Weil sie dich an deine düsteren Stunden erinnerten? Oder interessierte dich schlicht nicht, wie es anderen ging? Weil du an der Oberfläche bleiben wolltest? Fürchtetest du das Aufdecken deiner eigenen Tiefen? Was hat dich in deinem Leben so sehr verletzt, dass du die Entdeckung befürchtetest?
Und so trugst du eine Maske. Schafftest Distanz. Ich hatte Ahnungen, was dahinter versteckt sein könnte. Sicher war ich nie. Ich kam sprichwörtlich nicht an dich heran. So hieltst du alle auf Abstand. Wovor hattest du Angst? Dass Nähe dich verletzbar gemacht hätte? Vor neuen Wunden? Sogar bei mir? Ich habe dich geliebt. Und wäre dir gerne nah gewesen. Ich hätte deine Nähe gebraucht. Und kam nicht zu dir durch. Auch jetzt hast du dich mir wieder entzogen. Darum bleiben mir nur diese Briefe.
(„Alles aus Liebe“, XXXI)